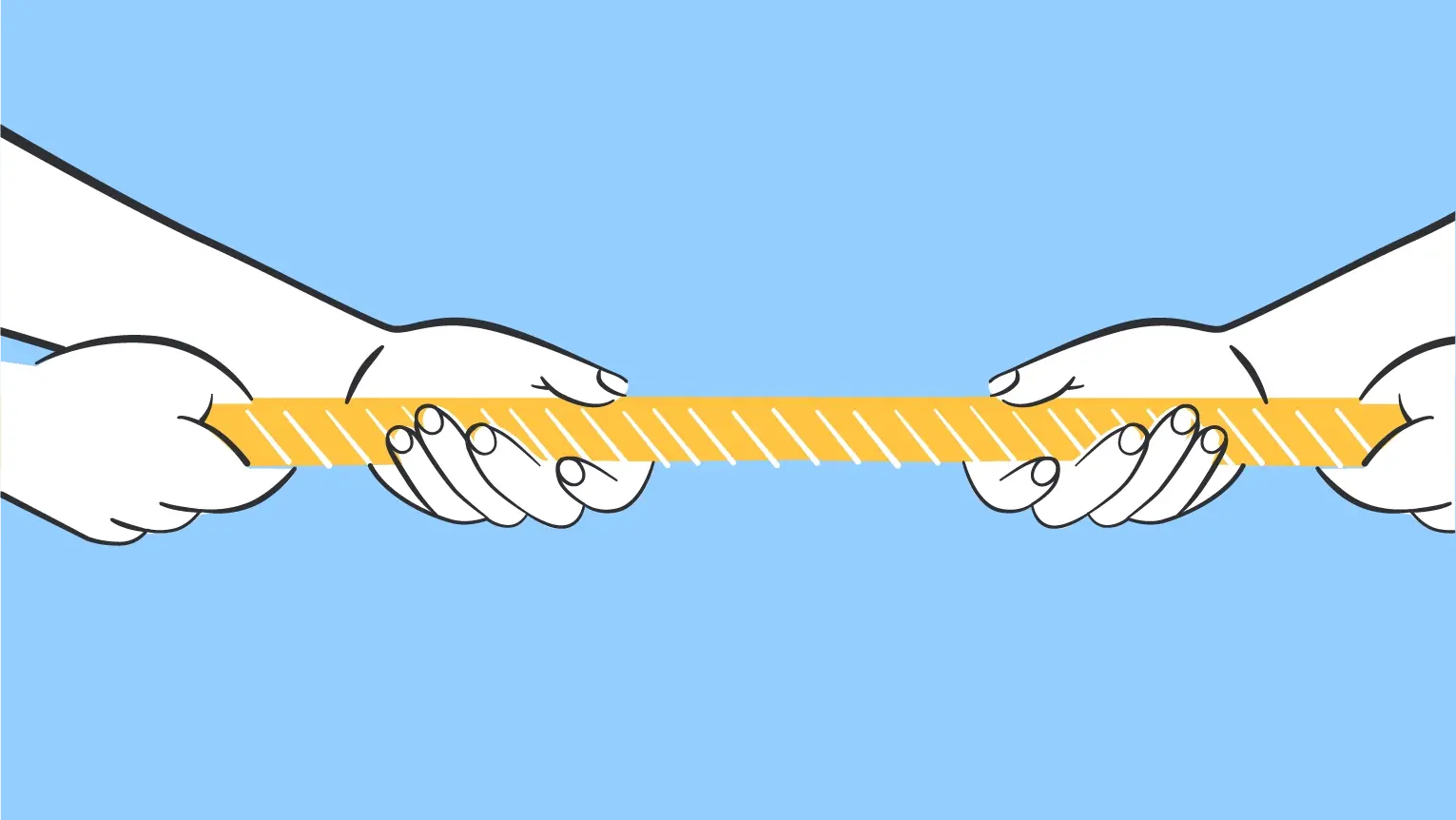
Gastkommentare : Ein Pro und Contra: Die Kanzler-Amtszeit begrenzen?
Sollten die Amtsperioden des Bundeskanzlers begrenzt werden? Stephan Hebel spricht sich dafür aus, Daniela Vates ist dagegen.
Pro
Dem Wechsel helfen

Eine Kommission, so steht es im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, solle Vorschläge "zur Begrenzung der Amtszeit des Bundeskanzlers/der Bundeskanzlerin prüfen". Na immerhin, ließe sich sagen, ein Prüfauftrag. Es ist zu hoffen, dass die Prüfung positiv ausgeht, am besten gleich in der ersten Legislaturperiode des Kanzlers Olaf Scholz. Dann wüssten er und wir gleich, dass seine Ära spätestens 2029 endet - oder 2030, falls der Abstand zwischen den Wahlen auf fünf Jahre verlängert wird.
Es gibt viele Gegenstimmen zu einer Amtszeitbegrenzung, und oft laufen sie auf die Befürchtung hinaus, in der jeweils zweiten Periode eines Amtsinhabers werde es nur noch Nachfolgekämpfe geben. Aber was ist das für ein Verständnis von lebendiger Demokratie? Hören wir nicht ständig das Bekenntnis, zur Demokratie gehöre nun mal der Wechsel?
Wer ihn wirklich will, den Wechsel, sollte ihm auch gesetzlich nachhelfen. Das gilt vor allem in Zeiten der zunehmenden Personalisierung von Politik. Selbst die größten Fans von Angela Merkel werden nicht ernsthaft behaupten, es sei das demokratische Nonplusultra, wenn eine Amtsinhaberin praktisch allein mit dem Satz "Sie kennen mich" eine Wahl gewinnt.
Der Zwang zum Wechsel nach acht oder zehn Jahren würde die Parteien unter produktiven Druck setzen, sich ihrer Grundsätze für die inhaltliche und personelle Aufstellung in der näheren Zukunft immer wieder neu zu vergewissern - und sie bei Bedarf zu ändern. Ja, das würde zu Diskussionen führen, auch zu Streit. Aber ist es nicht das, was Demokratie ausmacht? In ihr sollte Ruhe weder erste Bürgerpflicht sein - noch gar die Pflicht des politischen Personals.
Contra
Gesetz ist unnötig

Es klingt praktisch: Jede Kanzlerschaft wird mit einem Haltbarkeitsdatum versehen. Danach muss der oder die Regierende ihren Job zur Verfügung stellen, egal was gerade los ist. Wechsel wäre garantiert, und die Opposition müsste nicht seufzend gegen die Gewohnheit der Deutschen anrennen, Amtsinhaber einfach wiederzuwählen.
Aber diese Pflicht zum Wechsel wäre nicht mehr als eine Hilfskonstruktion. Schon jetzt muss kein Regierungschef darauf warten, bis er abgewählt wird. Es ist nicht nötig, sich per Skandal oder Affäre selbst ins politische Aus zu befördern. Man kann auch einfach irgendwann mal loslassen. Angela Merkel hat das gerade vorgemacht: Sie hat befunden, dass es irgendwann auch mal gut ist mit dem Regieren, wenn auch erst nach vier Wahlperioden. Allerdings: In ihre dritte Amtszeit startete sie mit einem phänomenalen Wahlergebnis. Den meisten Wählern war da ganz offenkundig nach allem anderen zumute als nach Wechsel.
Besser als rechtliche Vorschriften wäre also ein Wandel der politischen Kultur: weg vom Klammern an Schulterklappen, hin zur Erkenntnis, dass sich auch beim neugierigsten und reformhungrigsten Politiker irgendwann mal Ermüdungseffekte einstellen, über die gleichzeitig gewachsene Routine nicht mehr hinweghilft. Es ist ein erster Schritt, wenn etwa Bayerns Ministerpräsident Markus Söder dafür plädiert, die Amtszeit auf zwei Wahlperioden zu begrenzen. Die Erkenntnis scheint vorhanden. Um ihr nachzugehen, braucht es kein Gesetz.
Auch kürzere Amtszeiten können übrigens unendlich lange dauern und tranig wirken. Eine Ideen-Feuerwerks-Garantie wäre mit der Amtszeitbegrenzung schließlich nicht verbunden.