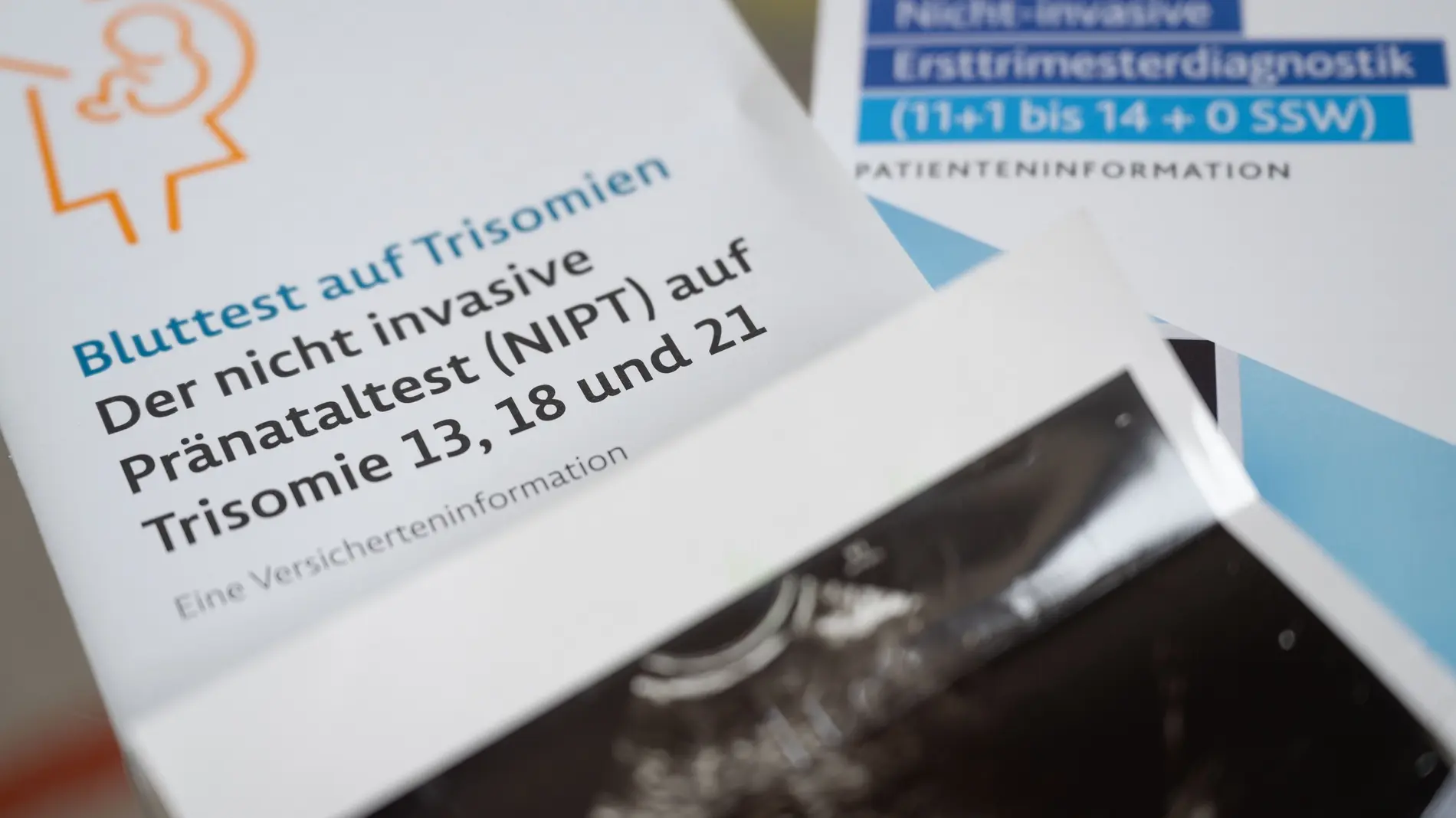Pränataldiagnostik in Deutschland : Ein medizinischer Fortschritt als gesellschaftliches Dilemma?
Viele werdende Eltern wollen wissen, ob ihr Baby gesund sein wird. Was leisten vorgeburtliche Untersuchungen und wozu führt der wachsende Einfluss von Pränataltests?
Als Vera Bläsing (42) erfährt, dass sie ihr erstes Kind erwartet, ist sie euphorisch. "Mein Mann und ich wollten uns so gut wie möglich informieren und alles richtig machen mit dem Baby, so mit Biokost und regionalen Produkten", sagt die Architektin und lacht am Telefon. Regelmäßig geht sie zur Frauenärztin, zahlt sogar für zusätzliche Untersuchungen. In der 13. Schwangerschaftswoche macht sie das "Ersttrimester-Screening", bei dem anhand ihrer Blutwerte, ihres Alters und der Werte der sogenannten Nackentransparenzmessung bestimmt wird, wie wahrscheinlich es ist, dass ihr Baby mit einer Trisomie 13, 18 oder 21 geboren wird. Bläsing ist damals 34, statistisch liegt ihr Risiko, ein Kind mit Down-Syndrom zu bekommen, bei 1:306.
Screening zeigt keine Auffälligkeiten
"Mein Mann und ich wollten das Screening deshalb erst nicht machen, es kostet ja auch Geld", erzählt sie. "Aber dann dachten wir, ist doch nicht schlecht, dann haben wir gleich noch ein Bild vom Baby. Und es wird schon nichts sein."

Der nicht invasive Pränataltest (NIPT) ist ein Bluttest auf die Trisomien 13, 18 und 21. Diese Trisomien sind seltene genetische Veränderungen, die die körperliche und geistige Entwicklung unterschiedlich beeinflussen.
Das Screening zeigt keine Auffälligkeiten, das individuelle Risiko der werdenden Mutter wird mit 1:1.487 berechnet. Bläsing und ihr Mann wollen bei dieser geringen Wahrscheinlichkeit keine Fruchtwasseruntersuchung machen und die Schwangerschaft nur noch genießen. Sechs Monate später wird ihr Sohn Fabian geboren. Gleich nach der Geburt äußert der herbeigerufene Kinderarzt den Verdacht, der Kleine mit den leicht schräg stehenden Augen könnte Trisomie 21 haben, das Down-Syndrom. Er behält Recht. "Wir sind aus allen Wolken gefallen", erzählt Bläsing. Zwei Tage hätten sie gebraucht, um den ersten Schock zu verarbeiten. Dann erst hätten sie ihren Eltern von der Geburt des Kindes erzählt.
Seltene Abweichungen: Rund eines von 700 Kindern wird mit Trisomie 21 geboren
Etwa vier von hundert Neugeborenen kommen hierzulande mit einer Fehlbildung auf die Welt. Die meisten haben therapierbare Herzfehler oder Neuralrohrdefekte, die gewöhnlich nach der Geburt operativ verschlossen werden. Chromosomenveränderungen wie das Down-Syndrom sind deutlich seltener. Rund eines von 700 Kindern wird mit Trisomie 21 geboren, die Wahrscheinlichkeit steigt mit dem Alter der Mutter.
Jenseits aller Wahrscheinlichkeiten fragen sich viele Schwangere, ob mit ihrem Kind wohl "alles in Ordnung" ist. In der Hoffnung auf Gewissheit lässt die Mehrheit ihre Babys auch über die drei in den Mutterschaftsrichtlinien vorgesehenen Ultraschalluntersuchungen durchleuchten und vermessen - durch feindiagnostische Ultraschalluntersuchungen, das Ersttrimester-Screening oder Analysen von Blut und Fruchtwasser, oft auf eigene Kosten. Das geht dem jüngsten Bericht des Bundestagsausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung zum Stand der Pränataldiagnostik hervor.
Beratung vor einer vorgeburtlichen Diagnostik empfohlen
Sei es bei der Schwangerenvorsorge ab den 1960er Jahren in erster Linie darum gegangen, nach der Gesundheit der Mutter und dem guten Fortgang der Schwangerschaft zu schauen, diene die Pränataldiagnostik heute einem anderen Zweck, meint die Pfarrerin Claudia Heinkel: "Der gezielten Suche nach Abweichungen beim Kind." Die Beraterin hat bis vor kurzem in Stuttgart die Fachstelle für Information, Aufklärung und Beratung zu Pränataldiagnostik und Reproduktionsmedizin geleitet, an sie wandten sich Schwangere, bei denen die vorgeburtliche Untersuchung Auffälligkeiten ergeben hat. Sie sagt: "Das Bild von Behinderung ist das Kind mit Down-Syndrom und danach wird bei der Pränataldiagnostik systematisch gesucht". Für werdende Eltern habe diese Suche inzwischen "Norm-Charakter". Es brauche viel Wissen, um sich dagegen zu entscheiden.
Pro familia rät Frauen und Paaren, sich vor einer vorgeburtlichen Diagnostik beraten zu lassen, und sich klar zu machen, was diese leisten kann und was nicht. So könne man damit "Erkrankungen feststellen, die nach der Geburt behandelbar sind", und die Geburt entsprechend vorbereiten, heißt es auf der Internetseite der Familienberatungsstelle. Es könnten aber auch nicht-therapierbare Erkrankungen gefunden werden. Niemand könne dann sicher sagen, wie stark das Kind betroffen sein wird.
Die Kosten für zusätzliche Untersuchungen übernehmen die Krankenkassen nur bei Risikoschwangerschaften oder Hinweisen auf Auffälligkeiten. Um eine Chromosomenanomalie sicher festzustellen, sind invasive Methoden notwendig, bei denen Gewebeproben aus dem entstehenden Mutterkuchen, Fruchtwasser oder kindliches Blut entnommen werden. Sie kosten besorgte Schwangere ohne Indikation schnell mehrere hundert Euro und können in seltenen Fällen zu Fehlgeburten führen.
Warum der NIPT zum Reizthema geworden ist
Auch aus diesem Grund werden sogenannte nichtinvasive molekulargenetische Bluttests, kurz NIPT, bei den Eltern in spe immer beliebter. Der Mutter wird dabei ab der zehnten Schwangerschaftswoche Blut abgenommen, um in den darin schwimmenden Teilen der kindlichen Erbsubstanz nach Chromosomenabweichungen zu suchen; auf Wunsch kann dabei gleich das Geschlecht des Kindes bestimmt werden. Die Tests, die künftig auch Einzelgen-Erkrankungen wie Mukoviszidose und spinale Muskelatrophie aufspüren sollen, sind seit 2012 auf dem Markt, sollen in erster Linie die Trisomien 13, 18 und 21 erkennen und werden von Frauenarztpraxen für 200 bis 300 Euro angeboten. Die Hersteller preisen die "große Sicherheit" und "hohe Genauigkeit", der Nachteil: Bei den meisten angeborenen Erkrankungen sind die Chromosomen gar nicht auffällig. Außerdem kann der Test, insbesondere bei jüngeren Frauen, zu falsch-positiven Ergebnissen führen. Daher empfehlen Ärzte, ein auffälliges Testergebnis in jedem Fall invasiv abklären zu lassen.
„Der Test kann nur sagen, ob das Kind wahrscheinlich eine Trisomie hat oder nicht.“
Spätestens seit Herbst 2019 ist NIPT zum Reizthema geworden. Damals beschloss der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA), das höchste Beschlussgremium von Ärzten, Psychotherapeuten, Krankenhäusern und Krankenkassen, dass der Bluttest bei Verdachtsfällen künftig von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt werden soll. NIPT sei schonender als invasive Verfahren wie die Fruchtwasserpunktion und könne so Fehlgeburten verhindern, heißt es zur Begründung. Für die ehemals stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Claudia Wiesemann, eine "richtige Entscheidung". Sie meint, Frauen sollten über die Durchführung "nach angemessener Beratung selbstbestimmt entscheiden können". Auch junge Frauen könnten "ganz individuelle Gründe haben, ein solches Wissen zu erlangen". NIPT als Screening-Test bei allen Schwangeren lehnt Wiesemann jedoch ab, weil dann die Rate der falsch-positiven Befunde steige.
Vom Einzelfall zum Regelfall?
Dass NIPT zum Regelfall der Pränataldiagnostik werden könnte, fürchten jedoch die Gegner des Bluttests auf Rezept. "Faktisch hat der G-BA eine indikationslose Kassenleistung beschlossen", urteilt Claudia Heinkel, die sich mit Vera Bläsing und anderen Kritikern im Bündnis #NoNIPT zusammengeschlossen hat. "Die subjektive Besorgnis der Schwangeren ist dafür das einzige Kriterium." Heinkel fürchtet "fatale Konsequenzen", nicht nur, weil die Kassenleistung signalisiere, "dass es empfehlenswert ist, den Test zu machen, um Kinder mit Down-Syndrom zu entdecken". Auch täusche er falsche Sicherheit vor: "Der Test kann nur sagen, ob das Kind wahrscheinlich eine Trisomie hat oder nicht."
Der Regelfall sei "so sicher wie das Amen in der Kirche", prognostiziert auch der Mainzer Pränatalmediziner Alexander Scharf, der zusammen mit weiteren Ärzten, Behindertenverbänden und Kirchen im Februar einen Protestbrief an den G-BA verfasst hat. Er verweist auf eine Einschätzung des German Board and College of Obstetrics and Gynecology aus dem Jahr 2019, die von einer mindestens 90-prozentigen Inanspruchnahme des NIPT ausgeht.
Schwankende Datenlage bei Entscheidung für einen Abbruch der Schwangerschaft
Die Begründung des G-BA, wonach der NIPT die Fruchtwasseruntersuchung ersetzen und hierdurch ausgelöste Fehlgeburten wirkungsvoll vermeiden könne, hält Scharf überdies für "unwissenschaftliches, simplifizierendes Wunschdenken". Er warnt: Falsch positive Befunde könnten ohne anschließende Fruchtwasserpunktion zu Abtreibungen, auch von gesunden Föten, führen. Zudem würden viele Frauen bald nur noch auf den kostenlosen Bluttest setzen und die viel aussagekräftigere Kopplung der Diagnostik an eine qualifizierte Ultraschalluntersuchung weglassen.
Wie viele Frauen in Deutschland sich wegen einer Behinderung ihres Kindes zum Abbruch der Schwangerschaft entscheiden, ist unklar. Die Zahlen schwanken in den wenigen verfügbaren Studien zwischen 67 und 85 Prozent. "Die meisten steigen aus", berichtet Scharf aus der Praxis.
Dabei sind Schwangerschaftsabbrüche mit der direkten, ausschließlichen Begründung einer Behinderung des Fötus seit 1995 nicht mehr erlaubt. Nur wenn der Arzt bescheinigt, dass dadurch die psychische Gesundheit der Schwangeren gefährdet ist, sind sie weiterhin legal.
Betroffene: “Jeder muss selbst entscheiden”
Der Sohn von Vera Bläsing ist heute sieben und geht in die erste Klasse einer Kerpener Grundschule. "Wegen seiner Entwicklungsverzögerung haben wir Fabian ein Jahr zurückstellen lassen, aber sonst ist er ein aufgeweckter Kerl, der sich gut verständlich machen kann, gerne schwimmt und seit einem halben Jahr Fahrrad fährt." Bläsing hat eine Down-Syndrom-Selbsthilfegruppe gegründet. Schwangeren und Paaren, die nach einer vorgeburtlichen Diagnose Rat suchen, erzählt sie von ihren Erfahrungen. Sie wolle Mut machen, aber auch niemanden überreden, das Kind zu behalten. “Das muss jeder selbst entscheiden.”
In ihrer zweiten Schwangerschaft habe sie nur einen erweiterten Organ-Ultraschall gemacht, um einen Herzfehler auszuschließen. Die heute fünfjährige Tochter kam ohne Down-Syndrom zur Welt. Wie sie sich entschieden hätten, wenn sie von Fabians Behinderung schon in der Schwangerschaft gewusst hätten? "Das kann ich nicht sagen", sagt Bläsing nachdenklich. "Wir sind froh, dass wir das nicht entscheiden mussten."