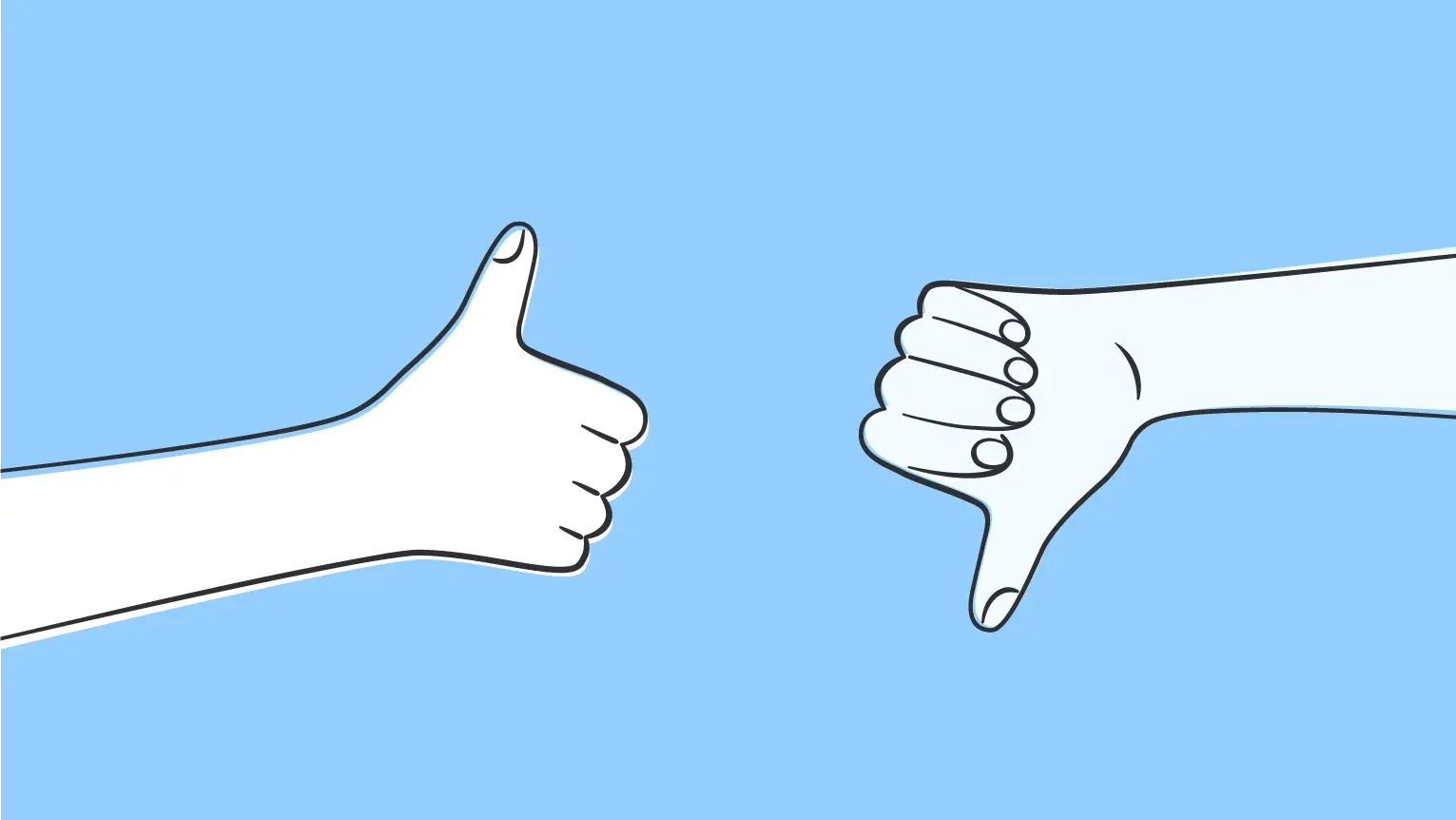
Gastkommentare : Soll der Staat IP-Adressen speichern dürfen? Ein Pro und Contra
Sollte der Staat zur Strafverfolgung IP-Adressen speichern dürfen? Ein Pro und Contra von Helena Bubrowski und Markus Decker.
Pro
Besser als der Zufall

Seit mehr als 15 Jahren streitet die Politik über die Vorratsdatenspeicherung. In dieser Frage zeigt sich das Spannungsverhältnis von Freiheit und Sicherheit wie unter einem Brennglas: Darf man die Daten aller Bürger speichern, weil die Polizei einen Teil davon zur Strafverfolgung braucht? Der Europäische Gerichtshof hat nun klargemacht, dass das keine Frage von Ja oder Nein ist, sondern von welche und wie lange. Er hat verschiedene rechtssichere Wege aufgezeigt. Einer davon: die allgemeine Speicherung von IP-Adressen für eine begrenzte Zeit.
IP-Adressen geben Rückschluss darauf, über welches Gerät Internetaktivitäten gelaufen sind. Sie werden bei jeder Einwahl neu vergeben. Für Ermittler sind sie oft der einzige Ansatzpunkt, um Straftaten im Internet aufzuklären, aber derzeit hängt es vom Zufall ab, ob die Adresse noch einem Anschluss zugeordnet werden kann.
Im Kampf gegen Kindesmissbrauch und Kinderpornographie ist die Anzahl der Verfahren, in denen mangels gespeicherter IP-Adresse kein Täter ermittelt werden konnte, wegen verbesserter Kooperation der Behörden gesunken. Es bleiben aber mehr als 2.000 Verbrechen pro Jahr, die deshalb ungesühnt bleiben. Die Bedeutung von IP-Adressen im Kampf gegen Extremismus steht weniger im Fokus, obwohl sie da sehr hilfreich wären. Das zeigt der Terroranschlag von Hanau: Der Täter hatte auf seiner Internetseite rassistischen Hass verbreitet, es gab 500 Zugriffe vor der Tat. Es ist nicht mehr zu ermitteln, ob das Mitglieder eines rechtsextremem Netzwerks waren.
Datenschutz hat zurecht einen hohen Stellenwert, aber er gilt nicht absolut. Ohne die Speicherung von IP-Adressen zahlt die Gesellschaft an anderer Stelle einen Preis, der zu hoch ist.
Contra
Alternative nutzen

Wenig ist so alt wie der Streit um die Vorratsdatenspeicherung. Seit bald zwei Jahrzehnten fordern Bundesinnenminister ihre Einführung, während Bundesjustizminister eben diese ablehnen. Dazwischen liegen zahlreiche Gerichtsurteile. Zwar hat der Europäische Gerichtshof nun zumindest die Speicherung von IP-Adressen erlaubt, doch besteht kein zwingender Grund, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen.
Zunächst würde diese Speicherung den Haupteinwand gegen die Vorratsdatenspeicherung ja bestätigen: dass nämlich die Daten aller Bürger erfasst würden, um den schweren kriminellen Handlungen einer kleinen Minderheit auf die Spur zu kommen. Überdies ist diese Speicherung gar nicht nötig. Denn wie Justizminister Marco Buschmann (FDP) ausführt, kann die große Mehrheit aller einschlägigen Hinweise auf sexuelle Gewalt etwa aus den USA schon heute auch ohne Vorratsdatenspeicherung ausermittelt werden. Und schließlich bliebe der Verdacht im Raum, dass die Speicherung von IP-Adressen zur Bekämpfung schwerer Kriminalität nur das Einfallstor wäre für die Bekämpfung aller potenziell rechtswidrigen Handlungen.
Buschmann hat Recht: Es gibt eine Alternative - die "Quick Freeze"-Methode, bei der einschlägige Daten erst gespeichert werden, wenn ein konkreter Verdacht im Raum steht und ein Richter zustimmt. Dann könnten auch Standort- und Verbindungsdaten gespeichert werden, nicht allein IP-Adressen. Dies wäre also nicht nur grundrechtsschonender, sondern womöglich sogar effektiver.
Deutschland sollte deshalb diesen Weg beschreiten - und den Streit um die Vorratsdatenspeicherung endlich zu den Akten legen.
