
Verschwörungstheorien : Nicht Ursache, sondern Symptom einer Demokratie in der Krise
Der Amerikanist Michael Butter warnt in seinem Buch "Die Alarmierten" vor einem falschen Alarmismus in Sachen Verschwörungstheorien.
Verschwörungstheorien zerstören die Demokratie. So lautet eine gängige These von politischen Stiftungen, NGOs oder Thinktanks. Der deutsche Amerikanist Michael Butter hält in seinem aktuellen Buch "Die Alarmierten" jedoch entgegen, dass sich diese These so nicht halten lässt. Zunächst seien Verschwörungstheorien "in den Ländern des Globalen Nordens vor allem unter der Anhängerschaft populistischer Bewegungen und an den Rändern des politischen Spektrums verbreitet", betont der Professor für Amerikanische Literatur- und Kulturgeschichte von der Universität Tübingen.
Kritischer Blick auf Berichterstattung zu “Querdenker”-Demos
Einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurde Butter mit seinem 2018 erschienenen Buch "Nichts ist, wie es scheint". Butter analysierte jene Verschwörungstheorien, die während der Migrationswelle von 2015 und der sich anschließenden innenpolitischen Krise aufkamen. Neben der Entwicklung von Verschwörungstheorien moderner Prägung in den USA und Europa nahm er insbesondere das Narrativ vom "Großen Austausch", nach dem die Bundesrepublik von einer globalen "Finanzoligarchie" mittels der "Migrationswaffe" und einer Islamisierung "ausgeschaltet" werden soll, unter die Lupe.
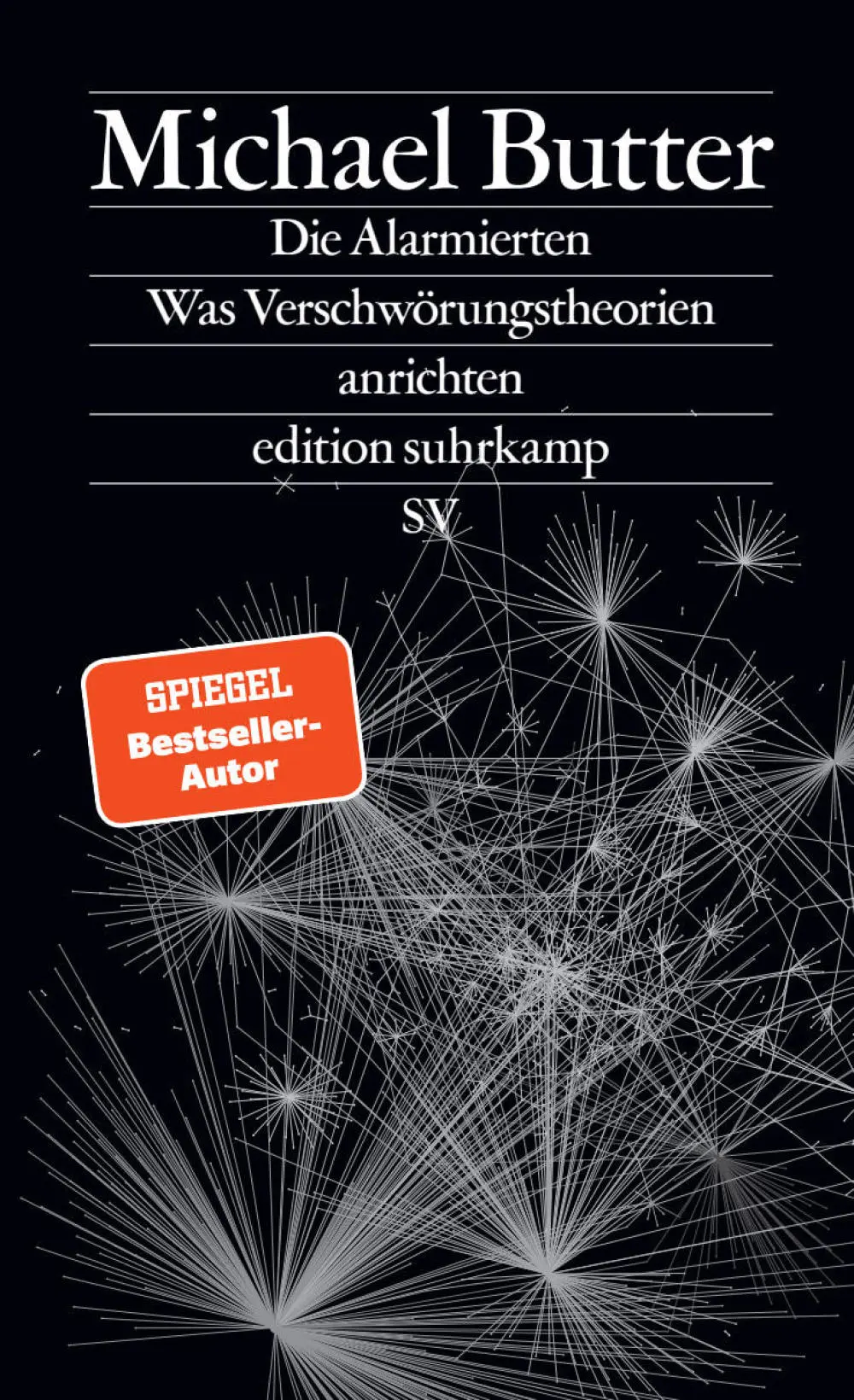
Michael Butter:
Die Alarmierten.
Was Verschwörungstheorien anrichten.
Suhrkamp,
Berlin 2025;
247 S., 22,00 €
In seinem aktuellen und ebenfalls empfehlenswerten Buch konzentriert er sich auf die Rolle von Verschwörungstheorien während und nach der Corona-Pandemie. Durchaus kritisch geht der Wissenschaftler dabei mit der Berichterstattung der Medien über die sogenannten "Querdenker"-Demonstrationen ins Gericht und erweist sich als ein unabhängiger Denker in Zeiten einer oftmals politisch-korrekten Publizistik. So widerlegt Butter sachkundig jene Autoren, die hinter jeder Verschwörungstheorie einen Beleg für Antisemitismus sehen. Zudem kritisiert er die Studien und Umfragen, die bis zu einem Drittel der deutschen Bevölkerung eine Neigung zu Verschwörungstheorien attestieren.
Autor leitet Forschungsprojekt zu Verschwörungstheorien
In Deutschland wird das Thema Verschwörungstheorien intensiv erforscht: Mehr als 50 Projekte befassen sich mit dem Phänomen, deutlich mehr als im übrigen Europa. Doch die Prämisse vieler dieser Projekte, wonach Verschwörungstheorien eine der größten Herausforderungen der Gegenwart darstellen, teilt Butter, der das von der Europäischen Union finanziertes Forschungsprojekt "Populism and Conspiracy Theory" leitet, ausdrücklich nicht.
In Deutschland seien Verschwörungstheorien im Unterschied zu den USA eben nicht ursächlich verantwortlich für die Krise der Demokratie. Vielmehr seien sie ein Symptom der Krise unserer demokratischen Gesellschaft. Ernst nehmen müsse man sie aber allemal.

Sicherheitsbehörden haben die Verschwörungstheoretiker inzwischen auf dem Schirm.

Wahrhaftigkeit ist keine politische Tugend, wusste Hannah Arendt. Doch Desinformation und der Wandel der Öffentlichkeit stellen Demokratien vor eine Herausforderung.

Die Kognitionspsychologin Hannah Metzler erklärt die Rolle von Gefühlen bei der Verbreitung von Fake News - und warum letztere ein Warnzeichen sind.