Sprache und Politik : Was politische Phrasen wirklich bedeuten
Weckruf, Eskalation oder Flächenbrand: Der Journalist Jörg Lau seziert in seinem Buch „Worte, die die Welt beherrschen“ gekonnt das Vokabular der Außenpolitik.
Von einem "Weckruf" ist in Europa immer wieder nach einem schockartigen Ereignis die Rede. Dieses Sprachbild suggeriert, dass Regierende, die offenbar geschlafen haben, mit einem Schlag die Dringlichkeit einer politischen Neuorientierung klar wird. Dies hätte schon nach der ersten Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten 2016 für Europa bedeutet, sich sicherheitspolitisch stärker auf eigene Beine zu stellen.
Doch die Europäer setzten darauf, dass sie sich weiterhin auf die Sicherheitsgarantien Amerikas verlassen könnten, bis der "Trump-Spuk" vorüber wäre. Die Europäer sind also nicht jäh in einer bösen Realität erwacht. Sie haben vielmehr in ihrer Politik bewusst "eine riskante Prioritätensetzung" vorgenommen, urteilt Jörg Lau. So seziert der Autor Versatzstücke des außenpolitischen Vokabulars, die im öffentlichen Diskurs vielfach strapaziert werden.
Floskeln verschleiern Gegensätze und verhüllen Interessen
Der Außenpolitik-Experte schreibt eine Kolumne mit dem Titel "In 80 Phrasen um die Welt". Jetzt hat er seine sprach- und ideologiekritischen Texte in einem Buch versammelt. Lau verweist darauf, dass in Deutschland seit Russlands Invasion in der Ukraine 2022 so viel und so heftig über Außenpolitik geredet wird wie noch nie. Aber die Debatte sei voller Floskeln, die Gegensätze verschleierten und Interessen verhüllten, statt die weltpolitische Wirklichkeit abzubilden. Stets pointiert und bisweilen polemisch rückt Lau daher Schlagworten wie "Eskalation" oder "Flächenbrand" zu Leibe. Er versteht sein Buch als ein Stück Aufklärung, aber auch als Anstoß zum Mitstreiten.
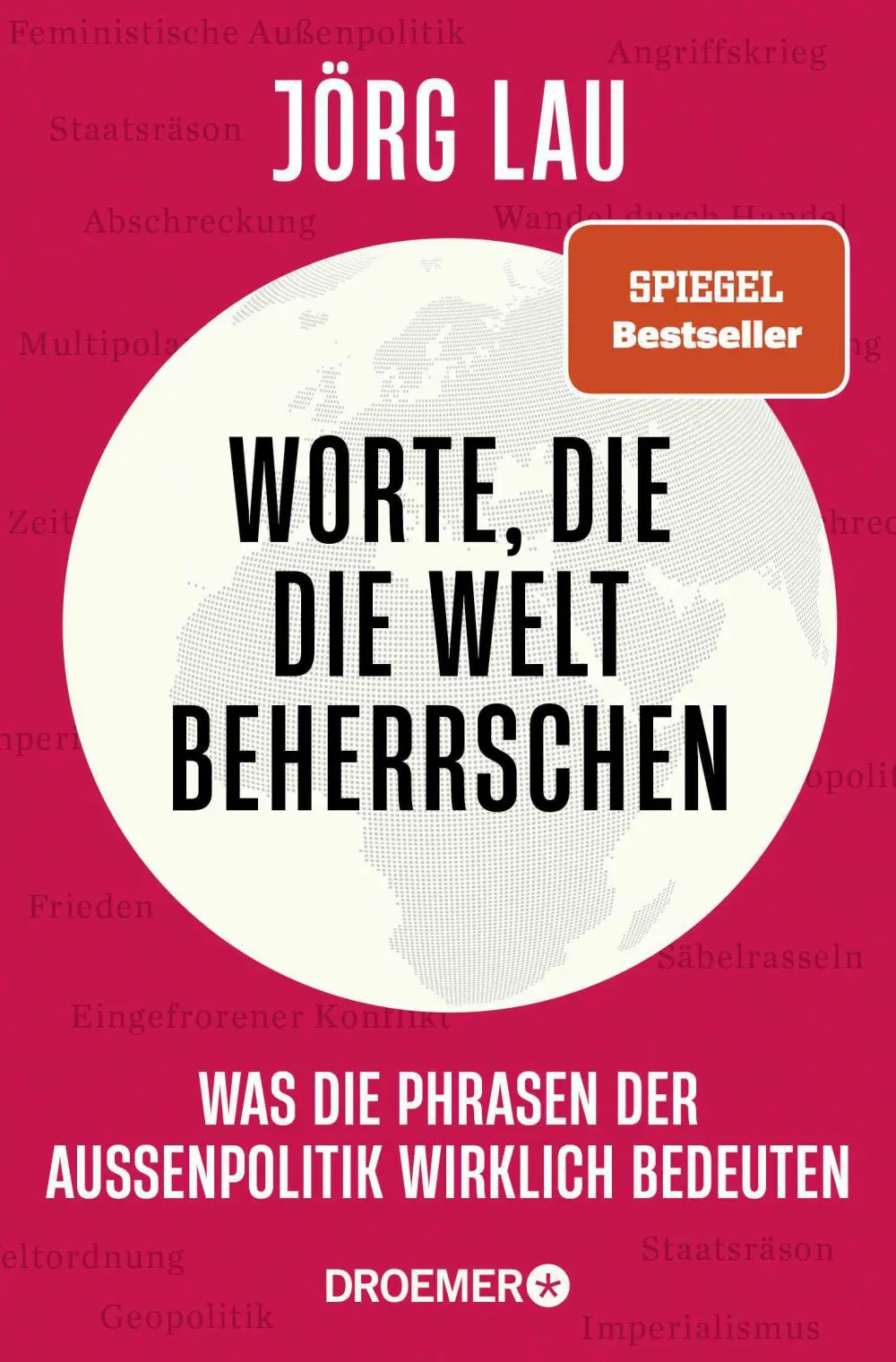
Jörg Lau:
Worte, die die Welt beherrschen.
Was die Phrasen der Außenpolitik wirklich bedeuten.
Droemer,
München 2025;
192 S., 18,00 €
Den Ruf nach einer "diplomatischen Lösung" im aktuellen Konfliktfall quittiert Lau mit dem Hinweis darauf, dass Diplomatie nur im Zusammenspiel mit anderen Instrumenten staatlicher Machtausübung wirksam sei, insbesondere mit einer glaubhaften Androhung militärischer Gewalt. Bei den Hoffnungen auf ein "Einfrieren des Konflikts" konstatiert Lau mit Blick auf Russlands Verhalten in Georgien und der Ukraine kühl, dieser Begriff beschönige "die aggressive Strategie einer imperialen Macht, die ihre Einflusszone durch Einschüchterung ausdehnt".
Konzepte der deutschen Außenpolitik auf dem Prüfstand
In seinem Wörterbuch stellt der Autor auch die Konzepte auf den Prüfstand, die Deutschlands Außenpolitik in den vergangenen Jahrzehnten bestimmt haben. Dies gilt etwa für den Versuch, unter dem Motto "Wandel durch Handel" Russland mittels ökonomischer Verflechtung politisch einzubinden - bis die Regierenden erkennen mussten, dass die "Modernisierungspartnerschaft" den Kreml keineswegs von einem neuen Kurs der Konfrontation abgehalten hat. Dies gilt ebenso für den Versuch, mit einem "kritischen Dialog" Irans Machthaber innen- und außenpolitisch zu mäßigen - bis offenbar wurde, dass Teheran eine immer radikalere Politik betrieb.
Von besonderem Wert sind Laus Betrachtungen, wenn er aufzeigt, dass hinter schön klingenden Formeln problematische Narrative stecken. Rein deskriptiv bezeichnet der Begriff "multipolare Weltordnung" ein internationales System, in dem es, anders als in der bipolaren Ära des Kalten Krieges zwischen Ost und West, eine Vielzahl von Machtzentren gibt. Tatsächlich ist er zur verbalen Waffe globaler Rivalen geworden. In die internationale Politik eingeführt wurde der Begriff im Mai 1997 durch einen gemeinsamen Brief des russischen und des chinesischen Botschafters an die UN-Vollversammlung. Die Initiative richtete sich explizit gegen die "westliche Hegemonie".
