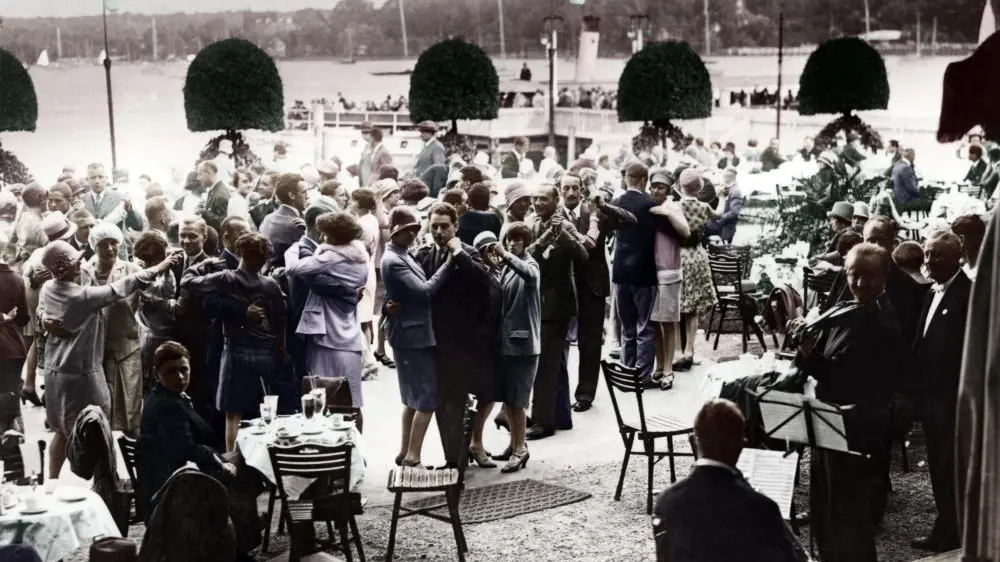Vor 105 Jahren : Bürger müssen ihre Waffen abgeben
Nach dem Ersten Weltkrieg bewaffneten sich Teile der deutschen Zivilbevölkerung in Einwohnerwehren und Freikorps. Die Folge: das Entwaffnungsgesetz.
Die Aufforderung prangte in großen Lettern auf einem Plakat: "Liefert die Waffen ab!" stand dort in Frakturschrift im Spätsommer 1920. Hintergrund war das sogenannte Entwaffnungsgesetz, das der Reichstag am 5. August 1920 beschlossen hatte. Ein notwendiger Schritt zur Erfüllung des Versailler Vertrages, in dem von den Alliierten unter anderem die Entwaffnung der deutschen Zivilbevölkerung festgeschrieben worden war.
Keine leichte Aufgabe. Denn erstens waren Waffenbesitzer damals noch nicht registriert, zweitens hatten sich in weiten Teilen des Reiches bewaffnete sogenannte Einwohnerwehren und Freikorps etabliert und drittens war zu klären, wer eigentlich zuständig für die Entwaffnung war.

Während eines Generalstreiks der Arbeiterschaft im März 1919 stehen bewaffnete Freikorpssoldaten auf dem Balkon des Hotel Adlon in Berlin.
Bei einem Treffen mit Reichskanzler Hermann Müller im April 1920 glaubte der Chef der Heeresleitung, General Hans von Seeckt, das Ziel, dass sich Militärbewaffnung nur in Händen der Reichswehr und Sicherheitspolizei befindet und alle übrigen Militärwaffen beseitigt werden, sei bei Geschützen und Minenwerfern leicht zu erreichen. Schwierig sei es hingegen bei anderen Waffen wie Maschinengewehren.
Abgelieferte Waffen waren "unverzüglich zum Gebrauch untauglich zu machen"
Beim selben Treffen vertrat Reichswehrminister Otto Geßler die Auffassung, die Entwaffnung sei zwar Sache der Polizeiorgane und damit der Landesregierungen. Das Reich könne aber einheitliche Normen über Strafen für das Nichtherausgeben von Waffen aufstellen. Das wurde mit dem Entwaffnungsgesetz getan.
Zwar entschied das Kabinett letztlich, dass die Entwaffnung auf Reichsebene durch das Reichsministerium des Innern ausgeführt werden sollte. Der Reichspräsident sollte jedoch einen Reichskommissar für die Entwaffnung der Zivilbevölkerung mit weitreichenden Befugnissen bestimmen. Der Kommissar konnte Fristen festlegen, bestimmen, "welche Waffen als Militärwaffen anzusehen sind" und musste die Entwaffnung organisieren.
Die Liste der abzugebenden Waffen war lang. Auch weil die Alliierten Druck bei dem Thema machten, legte man Tempo vor: Das Gesetz wurde am 11. August verkündet, Zeit, ihre Waffen bei einer zuständigen Behörde straffrei abzugeben, hatten die Bürger nur bis 1. November. Die abgelieferten Waffen waren "unverzüglich zum Gebrauch untauglich zu machen".
Bis Ende 1920 wurden 2,2 Millionen Gewehre abgegeben
Als Anreiz wurden Belohnungen versprochen - und Strafen angedroht. So wurden den Überbringern Prämien in bar versprochen: zum Beispiel 100 Reichsmark für ein Militärgewehr, das zwischen dem 15. September und 10. Oktober abgegeben wurde; 50 Reichsmark bei einer Abgabe bis 20. Oktober. Wer dagegen "nach dem 1. November Militärwaffen besitzt", hatte "schwere Freiheitsstrafen und Geldstrafen bis zu 300.000 Mark zu gewärtigen". Die Höchststrafe lautete zehn Jahre Zuchthaus.
Bis Ende des Jahres werden unter anderem 2,2 Millionen Gewehre, über 78.000 Revolver und Pistolen, mehr als 18.000 Maschinengewehre und rund 1.900 Maschinenpistolen eingezogen. Die Prämien schufen allerdings auch falsche Anreize: So wurden in der Zeit immer wieder Waffen aus Polizei- und Militärbeständen gestohlen, um sie zu Geld zu machen.