Jahresbericht 2024 der Wehrbeauftragten : Die Bundeswehr schrumpft und altert
Zum Ende der Amtszeit mahnt die Wehrbeauftragte Eva Högl das Personalproblem erneut als das größte Problem der Bundeswehr an - und befeuert die Wehrpflicht-Debatte.
Noch bevor Eva Högl (SPD) in der vergangenen Woche in ihrer Funktion als Wehrbeauftragte des Bundestags zum letzten Mal zu dessen Abgeordneten sprach, hatte sie bereits in einem Interview deutlich gemacht, woran es bei der Bundeswehr aktuell am dringendsten fehlt: Soldaten. "Ich glaube nicht, dass wir beim neuen Wehrdienst ohne eine Form von Pflicht auskommen werden - auch wenn ich mir wünschen würde, dass es ohne geht", sagte Högl, deren fünfjährige Amtszeit Ende der vergangenen Woche auslief, gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Högl: Mannschaftsstärke ist gegeenüber Vorjahr sogar geschrumpft
Dieser "neue Wehrdienst", den Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) noch in diesem Jahr verwirklichen will, sieht vor, dass alle volljährigen Männer einen Fragebogen mit Angaben über ihren Fitnesszustand und eine mögliche Bereitschaft für einen Wehrdienst ausfüllen müssen. Anschließend soll eine Musterung der Wehrdienstwilligen erfolgen. Frauen sollen den Fragebogen freiwillig ausfüllen können.

In der Aussprache zum Jahresbericht für 2024 räumt die Wehrbeauftragte Eva Högl (SPD) ein, dass die Bundeswehr dem Ziel von 203.000 aktiven Soldaten bis zum Jahr 2031 nicht näher gekommen sei.
Im Plenarsaal führte Högl in der Aussprache über ihren Jahresbericht 2024 den Ernst der Lage dann aus: Die Truppe werde "immer älter und sie schrumpft". Zwar seien 2024 die Bewerberzahlen um 18,5 Prozent, die Einstellungen um acht Prozent und die der Weiterverpflichtungen um 25 Prozent gestiegen. "Aber dem Ziel, 203.000 aktive Soldatinnen und Soldaten bis zum Jahr 2031 zu haben, sind wir leider immer noch nicht nähergekommen", stellte Högl fest. Im Gegenteil: Gegenüber dem Vorjahr sei die Mannschaftsstärke sogar geschrumpft auf 181.174 Soldaten. Und weiterhin breche jeder Vierte den Wehrdienst in der Probezeit wieder ab.
Koalition ist uneins über Rückkehr zur Wehrpflicht
Bei Pistorius rennt die Sozialdemokratin Högl mit ihrer Mahnung offene Türen ein. Bereits in der Woche zuvor hatte der Minister in der verteidigungspolitischen Debatte zur Regierungserklärung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) betont, man setze "zunächst" auf mehr Freiwillige, die Betonung liege aber auf "zunächst". In der SPD existieren jedoch große Widerstände gegen eine Rückkehr zu einer Wehrpflicht.
„Sie fühlen sich wohl, wenn es ein Raum ohne Chauvinismus und ohne Rassismus ist.“
Die Union hingegen macht keinen Hehl daraus, zur Wehrpflicht zurückkehren zu wollen - in Form eines verpflichtenden "Gesellschaftsjahrs" für Männer und Frauen, das wahlweise bei der Bundeswehr oder in einer zivilen Einrichtung geleistet werden kann. Der neue Wehrdienst werde sich "an klaren Zielzahlen messen lassen müssen", betonte denn auch der CSU-Abgeordnete Thomas Erndl und fügte an: "Angesichts der Größenordnung der Herausforderungen ist auch klar: Ohne eine Form von Pflicht wird es nicht gehen." Zumal sich aus den neuen Nato-Fähigkeitszielen Schätzungen von weitaus mehr als den angestrebten 203.000 Soldaten ableiten ließen.
Die Grünen und Linken hingegen lehnen eine Rückkehr zu Wehrpflicht ab. Auch wenn die bayerischen Grünen unlängst einen Vorstoß für einen sechsmonatigen verpflichtenden Gesellschaftsdienst gemacht hatten, der bei der Bundespartei jedoch auf Ablehnung stieß.
Die grüne Bundestagsabgeordnete Sara Nanni räumte jedoch ein, dass das Personalproblem der Bundeswehr die "größte Herausforderung der Zeitenwende" sei, Wehrdienstleistende, so befand sie, müssten "sich in der Truppe wohlfühlen", forderte Nanni. "Sie fühlen sich wohl, wenn es ein Raum ohne Chauvinismus und ohne Rassismus ist, in dem Kameradschaft gelebt wird, auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung."
Linke: Die Bundeswehr hat ein Problem mit Rechtsextremismus
Die Linken-Abgeordnete Zada Salihovic machte keinen Hehl daraus, dass die Bundeswehr ihrer Ansicht kein Ort des Wohlfühlens ist. Der Bericht der Wehrbeauftragten führe 275 extremistische Vorfälle allein im letzten Jahr an, die meisten davon rechtsextrem. "Das ist kein Betriebsunfall, das ist Alltag." Von Rassismus oder Sexismus betroffene Soldaten hingegen warteten oft vergeblich auf Konsequenzen. Die Bundeswehr habe ein Rechtsextremismusproblem, ein Gleichstellungsproblem und ein Führungsproblem. Sie brauche keine Aufrüstung, sondern "Aufklärung, politische Bildung, unabhängige Forschung", sagte Salihovic.
Aus Sicht des AfD-Abgeordneten Hannes Gnauck wiederum wird die Bundeswehr als "Experimentierfeld" für bürokratische und ideologische Auflagen und die Logik von Konzernen missbraucht. Sie müsse in erster Linie der Verteidigung Deutschlands dienen, "nicht für geostrategische Abenteuer" im Nahen und Fernen Osten, "nicht für endlose Auslandseinsätze und erst recht nicht für Stellvertreterkriege". Die AfD lehne Waffenlieferungen in die Ukraine ab, sagte Gnauck. Die Bundeswehr dürfe "nicht ausgeblutet werden, um die Interessen fremder Mächte zu bedienen".

Der Wehrbeauftragte soll die Bundeswehr kontrollieren und die Grundrechte in der Soldaten schützen. Das sorgt seit Bestehen des Amts mitunter für politischen Streit.

Trotz angespannter Personalsituation bei der Bundeswehr lehnt die Wehrbeauftragte Eva Högl eine Wiedereinführung der 2011 ausgesetzten Wehrpflicht ab.
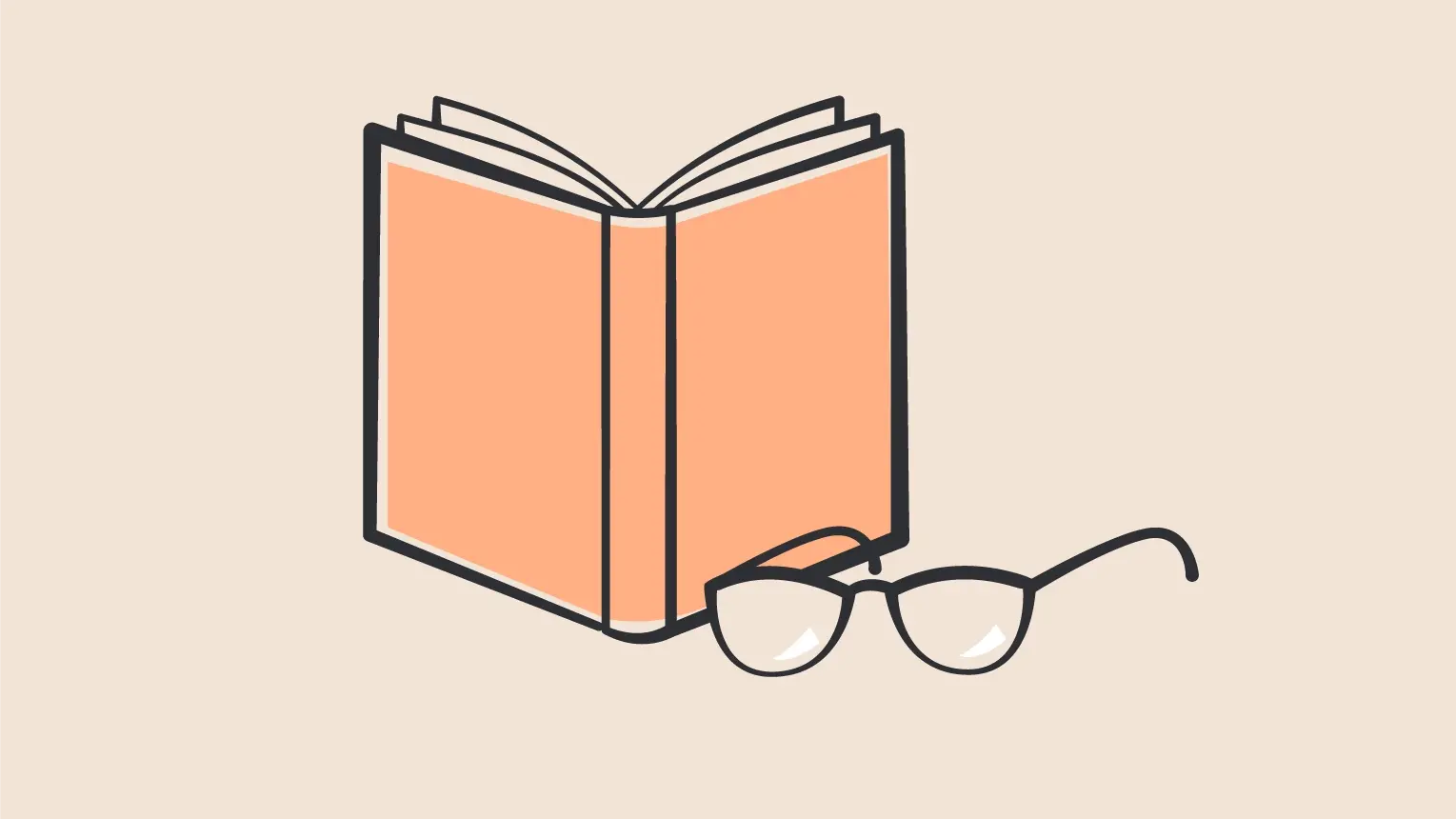
Der Militärhistoriker Sönke Neitzel blickt in seinem neuen Buch zurück auf 70 Jahre Bundeswehr. Und er fordert ein Umdenken in der Verteidigungspolitik.
