Michael Roth im Interview : "Das Gift maßloser Kritik"
In seiner offenherzigen Biografie schreibt der ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete Michael Roth über seine psychische Erkrankung und persönliche Verletzungen.
Herr Roth, in Ihrem Buch "Zonen der Angst" zeichnen Sie nicht nur Ihre politische Karriere nach, sondern schreiben auch über Ihre psychische Erkrankung, über Versagensängste und persönliche Verletzungen. Hatten Sie keine Angst, mit einem so offenherzigen Buch an die Öffentlichkeit zu gehen?
Michael Roth: Angst hatte ich keine. Aber es ist mir nicht leichtgefallen, über sehr Privates zu schreiben und dies mit einer großen Zahl von Menschen zu teilen, zumal ich darüber mit meinem engsten Umfeld, mit meiner Familie, nie gesprochen habe. Es sollte ein wahrhaftiges Buch sein - auch über meine psychische Erkrankung. Ich wollte aber nicht den Eindruck erwecken, die böse SPD und die hartleibige Politik allein hätten mich krank gemacht. Es gibt für diese Erkrankung Wurzeln und die reichen bis in meine Kindheit zurück.

Mit 28 Jahren zog Michael Roth erstmals in den Bundestag ein. Für die SPD war er von 1998 bis 2025 als Abgeordneter tätig.
Sie kritisieren namentlich führende Sozialdemokraten wie den ehemaligen Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich, der sie nicht einmal mehr grüßte im Bundestag wegen Ihrem vehementen Eintreten für Waffenlieferungen an die Ukraine. Haben Sie bereits Reaktionen von Parteifreunden erhalten?
Michael Roth: Die Rezensionen und Rückmeldungen von Leserinnen und Lesern sind erfreulich positiv. Ich bin mir bewusst, dass nicht allen alles gefallen wird. Das Buch ist aber keine Abrechnung. Zunächst einmal habe ich mich kritisch mit meiner eigenen politischen Arbeit auseinandergesetzt, auch mit meinen Fehlern und Schwächen. Ich konnte jedoch nicht aussparen, was mir in der Sache übel aufgestoßen ist. Ich habe versucht, es respektvoll zu tun.
Sie seien zu "sensibel" für die Politik, bescheinigte Ihnen Ihre Großmutter zu Beginn ihrer politischen Karriere. Mussten Sie oft an diese Warnung denken?
Michael Roth: Ich habe sehr oft daran gedacht. Meine Großmutter sagte das natürlich aus Liebe und Fürsorge. Aber das durfte für mich nicht entscheidend sein. Ich wollte mit meiner Art dafür werben, dass nicht nur die Dickfelligen und die Rabauken in der Politik bestehen. Es muss auch Raum geben für die Sensiblen, für diejenigen, denen es mitunter schwerfällt, notwendige Konflikte auszutragen und auszuhalten.
Ein SPD-Genosse meinte, sie hätten keine Zukunft in der Politik, weil sie keine Bratwurst essen, kein Bier mögen, nicht auf die Kirmes gehen und homosexuell sind. Haben es die Markus-Söder-Typen in der Politik leichter?
Michael Roth: Leicht haben es die Authentischen. Die Menschen haben ein gutes Gespür dafür, wer es ehrlich meint. In einem Hochleistungssport wie der Politik muss man sicherlich auch Dinge tun, die einem nicht immer schmecken. Aber ich wollte mich nie verstellen. Ich bin in einem ländlich geprägten Wahlkreis sieben Mal angetreten und habe ihn immer mit klaren Mehrheiten gewonnen. Besonders bewegt hat mich, dass ein regelrechter Wettbewerb herrschte, wer dem Michael die leckersten Torten backt, weil die Menschen wussten, dass ich Vegetarier bin und Kuchen mag. Das ist ein Zeichen großer Wertschätzung. Das ist auch mein Rat an jüngere Politiker: Bleibt euch selbst treu und gebt kein Schauspiel.
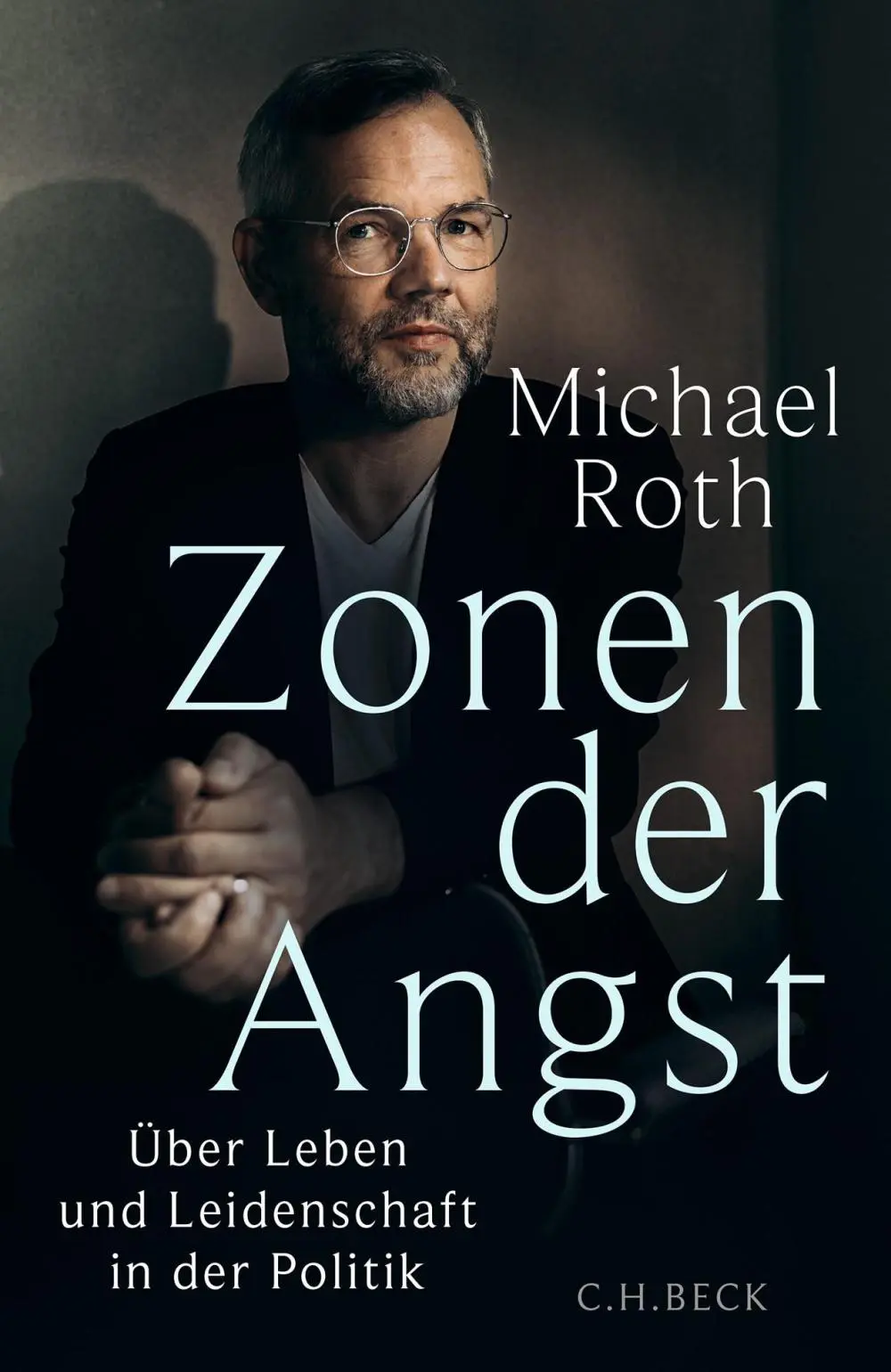
Michael Roth:
Zonen der Angst.
Über Leben und Leidenschaft in der Politik.
C.H. Beck,
München 2025;
302 S., 26,00 €
Sie sind 1998 erstmalig in den Bundestag eingezogen. Damals ging gerade die Ära von Bundeskanzler Helmut Kohl zu Ende und sein Nachfolger Gerhard Schröder führte die erste rot-grüne Koalition auf Bundesebene. Wo hat sich der Politikbetrieb seitdem am stärksten verändert?
Michael Roth: Er ist sehr viel schneller und hektischer geworden. Manchmal geht einem wirklich die Puste aus. Vor allem ist der Ton sehr viel aggressiver und wütender geworden. Ich habe mir in den vergangenen 30 Jahren noch nie so viele Sorgen um unsere liberale Demokratie gemacht wie aktuell. Die anständigen Demokraten sind zwar noch in der Mehrheit, aber der Ton wird inzwischen von denen dominiert, die die Demokratie verächtlich machen, die eher auf die Lüge und den Hass setzen als auf Respekt und Kompromissbereitschaft. Das muss von uns viel ernster genommen werden. Ich habe allerdings nicht den Eindruck, dass alle in der Regierung und Koalition den Schlag vernommen haben.
Sie schreiben, dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Befürworter von Waffenlieferungen an die Ukraine als "Kaliberexperten" bezeichnete und ihnen der ehemalige Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt ein "V2-Syndrom" bescheinigte. Müssen nicht auch die Vertreter der demokratischen Parteien an ihrem Tonfall arbeiten?
Michael Roth: Selbstverständlich. Das Gift der maßlosen Kritik, der Radikalität und der Schamlosigkeit im Umgang mit Worten greift gesamtgesellschaftlich um sich. Das ist schon lange nicht mehr nur ein Instrument rechtspopulistischer Kreise, auch im linken Milieu erlebe ich mitunter eine unterirdische Sprache. Wenn ich mir anhören muss, wie dort auf Juden und Jüdinnen und auf Israel verbal eingedroschen wird, dann frage ich mich schon, was das noch mit den Werten zu tun hat, für die die demokratische Mitte und die progressiven Kräfte in unserem Land stehen.
„Ich wollte selbstbestimmt aus der Politik scheiden, nicht hinauskomplimentiert werden.“
Auch wenn Sie betonen, dass die Politik nicht die Ursache für Ihre psychische Erkrankung war, so hat sie aber doch Ihre Probleme offenbar katalytisch verstärkt. Macht Politik krank?
Michael Roth: Der Politikbetrieb kann krank machen. Es gibt aber auch andere Berufe, die Körper und Geist massiv belasten können, beispielsweise der einer Krankenschwester oder eines Pflegers im Altenheim. Das Problem der Politik ist ihre Omnipräsenz. Es wird erwartet, dass sie sieben Tage lang rund um die Uhr präsent sind. In den 1970er-Jahren konnte sich ein Bundeskanzler Willy Brandt aus welchen Gründen auch immer eine Woche zurückziehen und von der Bildfläche verschwinden. Heute spielt das Land geradezu verrückt, wenn ein Kanzler es wagt, ein paar Tage "off" zu sein. Wir müssen schon prüfen, wie man Politik wieder menschlicher machen kann.
Vor einigen Jahren forderte die ehemalige Familienministerin Kristina Schröder einen politikfreien Sonntag. Wäre das sinnvoll?
Michael Roth: Als ich mich 2019 zusammen mit Christina Kampmann um den SPD-Vorsitz beworben habe, habe ich genau diesen Vorschlag gemacht. Politikern sollte die Chance eröffnet werden, mal Zeit mit ihren Familien zu verbringen, mit den Kindern zu spielen, nachzudenken oder einfach die Beine hochzulegen ohne ständig auf die Uhr zu schauen. Ich habe nie verstanden, warum dieser Vorschlag auf so viel Kritik stieß. Auch wenn Politik immer ein extrem anstrengender Beruf sein wird, könnten wir alle viel schlauer werden, wenn wir mehr Zeit für Muße, Ruhe, Sport und Familie hätten. Das habe ich nach meinem Abschied aus der Politik noch einmal deutlich gemerkt.
Sie beschreiben, dass Ihre innere Batterie bereits im Bundestagswahlkampf 2021 ziemlich leer war. Trotzdem machten Sie sich nach dem Wahlsieg Hoffnung auf einen Ministerposten. Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine waren sie dann quasi Dauergast in Talkshows. Wie erklärt sich dieser Widerspruch?
Michael Roth: Ich bin einer protestantischen Arbeitsethik verpflichtet. Abstriche habe ich meistens nur im Privaten gemacht. Das ist mir dann auch auf die Füße gefallen. Ich wollte unbedingt meine umstrittene Haltung, Frieden mit mehr Waffen zu schaffen, transparent machen und erklären. Das geht in einer Talkshow mit drei Millionen Zuschauern natürlich besser als im Hinterzimmer. Meine Karriereambitionen auf ein Ministeramt waren vor allem der anfänglichen Unterstützung durch meinen hessischen Landesverband geschuldet. Im Nachhinein kann ich froh sein, dass mir das erspart geblieben ist. Ich weiß nicht, ob und wie ich mit meiner Position zu Russland und den Waffenlieferungen an die Ukraine angesichts meiner psychischen Erkrankung in der Regierung von Olaf Scholz politisch überlebt hätte.

Was war das ausschlaggebende Argument, 2025 nicht mehr für den Bundestag zu kandidieren? War es Ihre psychische Erkrankung oder Ihre Entfremdung von der SPD?
Michael Roth: Das war eine Mischung aus mehreren Gründen. Für mich kam noch ein weiteres Argument hinzu. Ich habe sehr jung mit der Politik begonnen und bin mit 28 Jahren erstmals in den Bundestag eingezogen. Für mich war damals schon klar, dass ich nicht als Berufspolitiker in die Rente gehen möchte. Ich hatte den Eindruck, dass mit 55 Jahren der Zeitpunkt gekommen ist, noch einmal etwas Neues zu wagen. Vor allem wollte ich selbstbestimmt aus der Politik scheiden, nicht hinauskomplimentiert werden von den Wählern oder von meiner eigenen Partei.
Haben Sie über einen Austritt aus der SPD nachgedacht?
Michael Roth: Nie! Die SPD ist meine politische Familie, das wird sie auch immer bleiben. Aber es war schmerzvoll, dass mitunter der Eindruck erweckt wurde, ich würde mit meiner Haltung keine sozialdemokratische Position mehr vertreten. Dabei orientierte ich mich nicht nur in der Ukraine-Frage immer an der Überzeugung: Die Internationale erkämpft das Menschenrecht.
Mehr zu Michael Roth und der SPD

Seit 1998 sitzt Michael Roth im Bundestag - nun scheidet er aus. Der Sozialdemokrat warnt vor Überlastung und Angst im Politikbetrieb – auch aus eigener Erfahrung.

Seit Jahren diskutiert Deutschland über Waffenlieferungen an die Ukraine. Mittlerweile sind Milliardengelder für Militärgüter geflossen, doch die Kritik hält an.