Soziologe Ansgar Hudde im Interview : "Politische Blasen sind in der Minderheit"
Ansgar Hudde hat die letzten beiden Bundestagswahlen analysiert. Seine These: Die Mehrheit der Deutschen lebt in politisch heterogenen Nachbarschaften.
Herr Hudde, nach der Bundestagswahl Ende Februar kursierten in den Medien Karten, auf denen der Osten blau und der Westen schwarz eingefärbt waren - mit ein paar versprengten roten oder grünen Punkten in Groß- und Universitätsstädten. Hat sich Deutschland auseinandergelebt?
Ansgar Hudde: Solche Karten zeigen nur, welche Partei im jeweiligen Wahlkreis auf Platz eins liegt. Oft liegen aber nur wenige Prozentpunkte zwischen der stärksten und der zweitstärksten Partei. So verkennt man schnell, wie viel politische Vielfalt dahinter steckt, man bekommt ein schiefes Bild. Es gibt in Deutschland schon bedeutsame politische Unterschiede zwischen den Regionen. Aber die Mehrzahl der Bürger wohnt in Nachbarschaften, in denen das Wahlverhalten halbwegs nah am Bundestrend ist. Die politischen Blasen sind in der Minderheit.

Sie haben sich die Wahlergebnisse sehr detailliert angeschaut, auf der Basis der insgesamt 94.000 Stimmbezirke. Sind diese kleinen Nachbarschaften politisch homogen oder eher heterogen strukturiert?
Ansgar Hudde: Die meisten Nachbarschaften sind durchaus heterogen. Es gibt aber auch Gegenden, in denen man kaum politisch Andersdenkende treffen wird. In den zentrumsnahen Vierteln von Groß- und Universitätsstädten zum Beispiel findet man kaum konservativ oder rechts eingestellte Menschen, in einigen kleinstädtischen und ländlichen Regionen Bayerns dagegen kaum Wähler, die progressiv wählen. In Teilen Ostdeutschlands hat man teils starke Kontraste, weil die AfD sehr stark ist, aber auch die Linke überdurchschnittlich abschneidet. Dafür fehlt dort oft die breite demokratische Mitte.
Sie identifizieren vier typische Wahlmuster: Typischdeutschland, Konservativ, AfD-trifft-Linke, Grün-Links. Was steckt hinter diesen plakativen Begriffen?
Ansgar Hudde: Das Typischdeutschland nenne ich so, weil die Stimmverteilung hier ungefähr dem allgemeinen Trend entspricht. Zwei Drittel der Deutschen wohnen in Nachbarschaften mit diesem Wahlmuster. Man findet sie überall im Bundesgebiet, besonders häufig aber in westdeutschen Klein- und Mittelstädten. Im Konservativ-Wahlmuster sind die Freien Wähler auffällig stark, typisch dafür ist das ländlich geprägte Bayern, alles links der CSU schneidet hier schlecht ab. Im AfD-trifft-Linke-Muster liegt die AfD klar auf Platz eins, aber auch die Linke ist stärker als im Durchschnitt. Bei der Wahl 2025 war in diesem Milieu auch das BSW mit zehn Prozent überproportional vertreten. Dagegen sind alle Parteien schwach, die schon mal an einer Bundesregierung beteiligt waren. Dieses Wahlverhalten ist in Ostdeutschland außerhalb der Großstadtzentren in der Mehrheit, man findet es aber auch in manchen Bezirken im Westen, eine größere Häufung gibt es zum Beispiel im Ruhrgebiet oder in der Westpfalz. Als letztes habe ich das Grün-Links-Muster identifiziert: Hier sind die Grünen und die Linke sehr stark, während rechte Parteien wenig Stimmen bekommen. Dieses Wahlverhalten finden wir in den zentrumsnahen Gebieten der Groß- und Universitätsstädte, im Osten ebenso wie im Westen. Die Abweichung vom Bundestrend ist hier am größten. Insgesamt wohnt nur ein Zwölftel der Deutschen hier - allerdings besonders viele derjenigen, die mit Politik, Wissenschaft oder Medien zu tun haben.
„Als Orte, in denen die AfD sehr schwach ist, sind damit fast nur noch die zentrumsnahen Gebiete von Groß- und Universitätsstädten übrig.“
Wo genau haben Sie diese untypischen Nachbarschaften gefunden?
Ansgar Hudde: Bei der Bundestagswahl 2021 standen zwei Stimmbezirke an der Leipziger Eisenbahnstraße und zwei aus dem Stadtteil Vauban in Freiburg im Breisgau an der Spitze des Rankings, Gegenden also, die eine gewisse bundesweite Prominenz haben. Zur Bekanntheit der Eisenbahnstraße haben Medienberichte mit Titeln wie "Die kriminellsten 1,5 Kilometer Deutschlands" beigetragen. Es handelt sich um ein Altbauviertel, das sämtliche Klischees der Gentrifizierung erfüllt, es ist stark migrantisch geprägt, aber auch Studierende und andere junge Leute ziehen hin. Es gibt viele türkische oder arabische Geschäfte, dazu ein paar Hipster-Cafés und vegane Imbissbuden. Zeitungsartikel über Freiburg-Vauban haben dagegen Titel wie "Im Eldorado der Öko-Spießer". Der neu gebaute Stadtteil ist durch Familien aus der akademischen Mittelschicht geprägt, Studierende gibt es dort aber auch. Hier waren 2021 die Grünen extrem stark, 2025 sowohl Grüne als auch Linke. Die vier Stimmbezirke stehen auch in der Rangliste von 2025 wieder sehr weit oben. Hinzu gekommen ist ein Bezirk in Berlin-Kreuzberg rund um das Kottbusser Tor, und ein Bezirk in Hamburg-Mitte, auf der Insel Veddel.
Neben der Auswertung von Statistiken waren Sie vor Ort in Herford, Abensberg, Gera oder Köln unterwegs, als Beispiele für die beschriebenen Milieus. Was ist Ihnen aufgefallen, das sich aus den reinen Zahlen nicht erschließt?
Ansgar Hudde: Man spürt die Stimmung vor Ort. Ich fand es spannend, beides zusammen zu bekommen: die Zahlen zum Wahlverhalten und die persönlichen Eindrücke. Durch die Arbeit an dem Buch kann ich mir nun viel besser vorstellen, wie die Stimmung dort ist, wie die Nachbarschaft aussieht und wie sie sich anfühlt. Und andersrum genauso: Bin ich irgendwo unterwegs, kann ich ziemlich gut einschätzen, wie dort wohl gewählt wird.
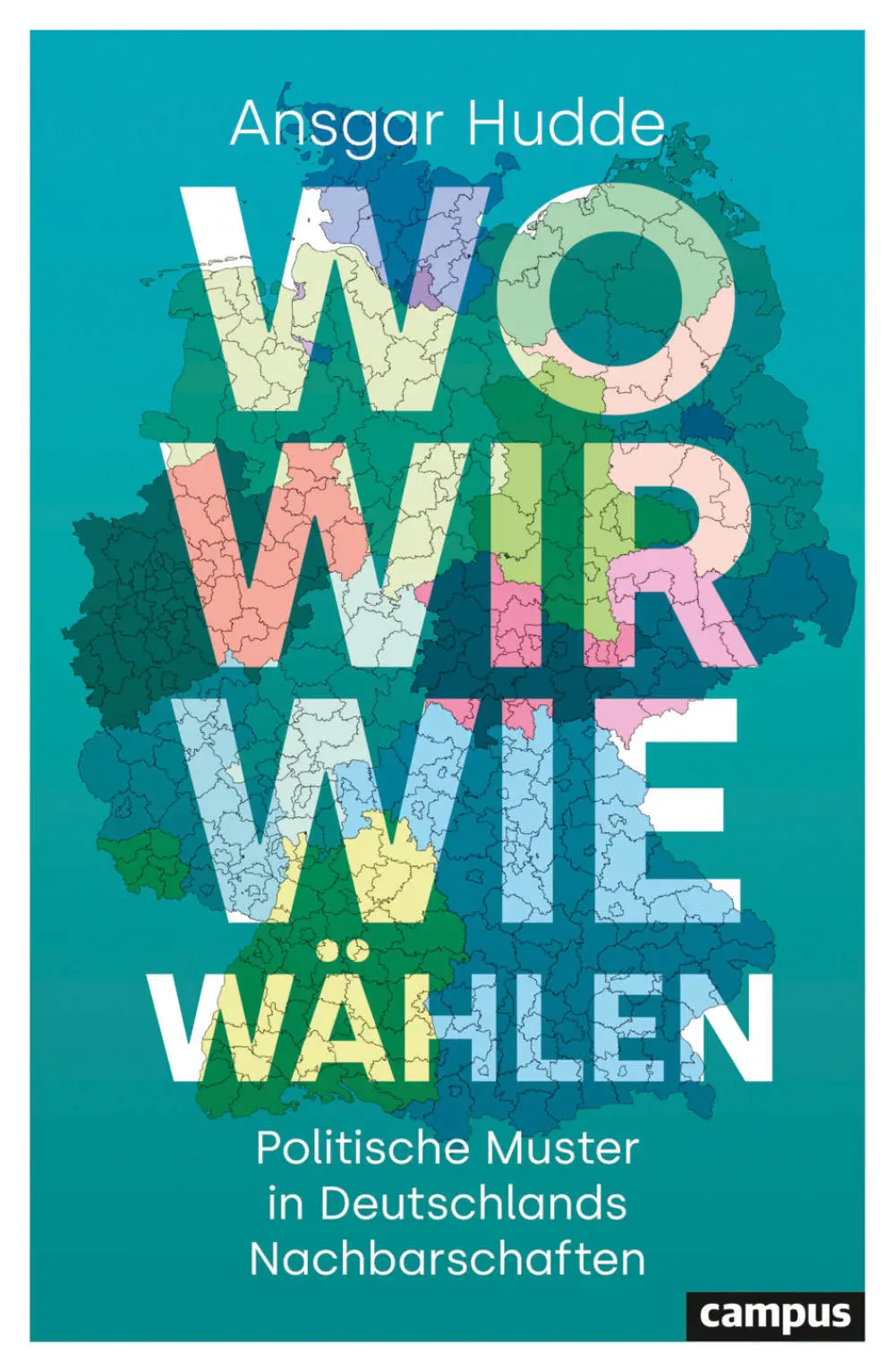
Ansgar Hudde:
Wo wir wie wählen.
Politische Muster in Deutschlands Nachbarschaften.
Campus,
Weinheim 2025;
262 S., 32,00 €
Ihre wichtigste Datengrundlage war nicht die Bundestagswahl 2025, sondern die von 2021. In diesen vier Jahren aber kam es zu gravierenden Verschiebungen im Wahlverhalten: Vor allem SPD und FDP haben an Rückhalt verloren, AfD und Linke zugelegt. Lässt sich Ihr Schema überhaupt noch weiter anwenden?
Ansgar Hudde: Ja, das Schema ist trotz dieser Änderungen sehr stabil. Ich habe inzwischen auch alle Hauptanalysen mit den Daten von 2025 nachgerechnet. Die Einteilung in die vier Wahlmuster funktioniert weiterhin. Wenn ich die Karten nebeneinander lege, muss man länger hinsehen, bis man Unterschiede entdeckt. Im Typischdeutschland ist das Wahlverhalten weiterhin nah am Bundestrend, im Konservativ-Wahlmuster ist es weiterhin konservativer. SPD, Grüne und Linke haben zusammen gerechnet 2025 ihr schlechtestes Ergebnis in über sechs Jahrzenten eingefahren. Dieses Minus zeigt sich in allen Wahlmustern, im Grün-Links-Milieu der Groß- und Universitätsstädte aber am geringsten. In ihren Hochburgen von 2021 haben diese Parteien am wenigsten verloren. Allerdings gab es 2025 eine bedeutende Verschiebung vor allem unter jungen Leuten und hier besonders bei den Frauen, weg von den Grünen hin zur Linkspartei.
Im Schlusskapitel des Buches beschreiben sie die Veränderungen nach der jüngsten Wahl im Detail. Wie unterscheiden sich die beiden Urnengänge in der regionalen Kartografie?
Ansgar Hudde: Das Hauptbild ist die große Stabilität. Die meisten Unterschiede zwischen Stadt und Provinz oder auch zwischen den Bundesländern bleiben bestehen. Natürlich hat sich einiges verändert. Man findet jetzt mehr AfD-trifft-Linke Nachbarschaften auch in westdeutschen Stimmbezirken, etwa in Gelsenkirchen, Kaiserslautern oder Pforzheim. Eine weitere interessante Verschiebung betrifft die ländlich-konservativen, katholisch geprägten Regionen im deutschen Nordwesten, im Emsland und im Münsterland. Dort bekam die AfD anfangs kein Bein auf die Erde, während die Union sehr stark blieb. Diese Resistenz gegen die AfD bröckelt nun aber, sie ist dort inzwischen fast genauso stark wie im Bundesschnitt. Als Orte, in denen die AfD sehr schwach ist, sind damit fast nur noch die zentrumsnahen Gebiete von Groß- und Universitätsstädten übrig.
„Das Gefälle zwischen den Zentren der Großstädte und dem Rest der Republik nimmt zu.“
Was ist Ihre Prognose, wie sich die beschriebenen Wahlmilieus künftig entwickeln? Wird sich zum Beispiel der Gegensatz Ost-West allmählich wieder auflösen?
Ansgar Hudde: Zu Ost und West wage ich keine Prognose. Auch beim Vergleich von 2021 und 2025 kommt es auf die spezifische Partei und auf die Perspektive an. Die Linkspartei zum Beispiel hat bei der letzten Wahl deutlich mehr im Westen dazugewonnen als im Osten. Die SPD hat in Ostdeutschland mehr als jede zweite Stimme verloren, im Westen "nur" etwas weniger als jede Dritte. Die AfD ist im Westen von acht auf 18 Prozent gewachsen, im Osten von 22 auf 36 Prozent. Nun könnte man diagnostizieren, die Landesteile entwickeln sich weiter auseinander, weil die AfD im Osten 14 Prozentpunkte dazugewonnen hat, im West aber nur zehn. Die Analyse könnte aber auch sein: Die AfD hat sich im Westen mehr als verdoppelt, in Ostdeutschland ist sie "nur" um zwei Drittel angestiegen. Mittlerweile kommt ein größerer Teil der AfD-Stimmen aus dem Westen, was man als Zeichen einer Angleichung verstehen könnte.
Und die Unterschiede zwischen Großstadt und Provinz? Gehen die Parteipräferenzen noch weiter auseinander?
Ansgar Hudde: Hier ist das Bild klarer: Das Gefälle zwischen den Zentren der Groß- und Universitätsstädte und dem Rest der Republik nimmt zu. Bewegt man sich aber aus diesen Nachbarschaften heraus, sind die Unterschiede gar nicht mehr so groß. Dieser Trend hat sich schon früh angedeutet und mit der Bundestagswahl 2025 nochmal deutlich verstärkt. Ich gehe davon aus, dass sich diese Entwicklung fortsetzt. Für Großstädter wie mich - und gerade auch für das politische Berlin - bedeutet das: Was ich vor der eigenen Haustür erlebe, ist keineswegs repräsentativ für die Stimmung im Land insgesamt.
