Vor 35 Jahren : Volkskammer beschließt den "Untergang der DDR"
Am 23. August 1990 stimmt die Volkskammer in einer Sondersitzung für den Betritt der DDR zur Bundesrepublik Deutschland zum 3. Oktober - da ist es drei Uhr morgens.

Nach einer dramatischen Sondersitzung in der Nacht vom 22. auf den 23. August 1990 und dem Beschluss über den Beitritt der DDR zur Bundesrepublik Deutschland zum 3. Oktober 1990 reagieren die Abgeordneten der Volkskammer mit stehendem Applaus.
„In sechs Wochen leben die Deutschen wieder in einem Staat.“ Mit diesen Worten begann Sprecher Joachim Brauner am 23. August 1990 die „Tagesschau“. In den frühen Morgenstunden hatte die Volkskammer in einer „dramatischen Nachtsitzung“, so Brauner, dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik am 3. Oktober zugestimmt – nach einer wochenlangen Hängepartie.
„Mit Ja haben 294 Abgeordnete gestimmt“, verkündete Volkskammerpräsidentin Sabine Bergmann-Pohl gegen 2.45 Uhr. Der Rest ging im Jubel unter. Damit stand fest, dass die erforderliche Zweidrittel-Mehrheit für die Beitrittserklärung in namentlicher Abstimmung erreicht worden war. Erleichterung machte sich breit. Denn noch Anfang August war das Vorhaben in der Volkskammer gescheitert.
DDR-SPD und DSU wollten bereits einen früheren Beitritt der DDR zur Bundesrepublik
Damals hatte das erste frei gewählte Parlament der DDR einen Antrag der DSU (Deutsche Soziale Union) abgelehnt, den Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes sofort zu erklären. Und auch ein SPD-Antrag, den Beitritt bis spätestens 15. September zu erklären, fiel durch. Mit knapper Mehrheit verabschiedeten die Abgeordneten dagegen einen Antrag von CDU und Demokratischer Aufbruch (DA). Darin wurden die Verfassungsorgane der Bundesrepublik gebeten, „die Möglichkeit zu eröffnen, die Wahlen zum gesamtdeutschen Parlament in Verbindung mit dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik am 14. Oktober 1990 durchzuführen“.
Doch letztlich verfehlte der Wahlvertrag sowohl in der Volkskammer als auch im Bundestag die notwendige Mehrheit: In Ost-Berlin hatten sich die Reihen der Regierungsfraktionen bereits gelichtet – schon an jenem 9. August wurde das Thema in einer nächtlichen Sitzung behandelt –, in Bonn stimmte die SPD gegen vorgezogene Wahlen am 14. Oktober. Die Sozialdemokraten wollten zwar eine möglichst schnelle Einheit, wollten aber beim vereinbarten Neuwahltermin am 2. Dezember bleiben.
Gysi kritisierte den Beschluss zum Beitritt
Zwei Wochen später beschloss die Volkskammer dann doch das Ende der DDR, den der Chef der SED-Nachfolgeorganisation PDS, Gregor Gysi, in der Debatte emotional als „Untergang der Deutschen Demokratischen Republik“ bezeichnete. Die Befürworter der Einheit regierten auf diese Worte mit stürmischem Applaus.
„Ich bedaure, dass die Beschlussfassung im Hauruckverfahren über einen Änderungsantrag geschehen ist und keine würdige Form ohne Wahlkampftaktik gefunden hat“, so Gysi. „Denn die DDR, wie auch immer sie historisch beurteilt werden wird, war für uns das bisherige Leben.“ Er sei aber „davon überzeugt, es gibt auch neue Chancen…“.
Bei den meisten Abgeordneten war von Bedauern über den „Untergang“ keine Spur. Das ganze Haus habe gejubelt blickte einmal der ehemalige DDR-Ministerpräsident Lothar de Maizière auf die Sitzung zurück. Zwar habe es auch Unsicherheiten gegeben, das Gefühl der Dankbarkeit und Erleichterung habe jedoch überwogen.
Am 23. August verabschiedete der Bundestag den gesamtdeutschen Wahlvertrag gegen die Stimmen der Grünen. Einen Tag später passierte er auch den Bundesrat mit großer Mehrheit. Am 31. August unterschrieben Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble (CDU) und DDR-Staatssekretär Günter Krause den 1.000 Seiten starken Einigungsvertrag. Er wurde in nur vier Sitzungen ausgehandelt.
Mehr zur Deutschen Einheit lesen
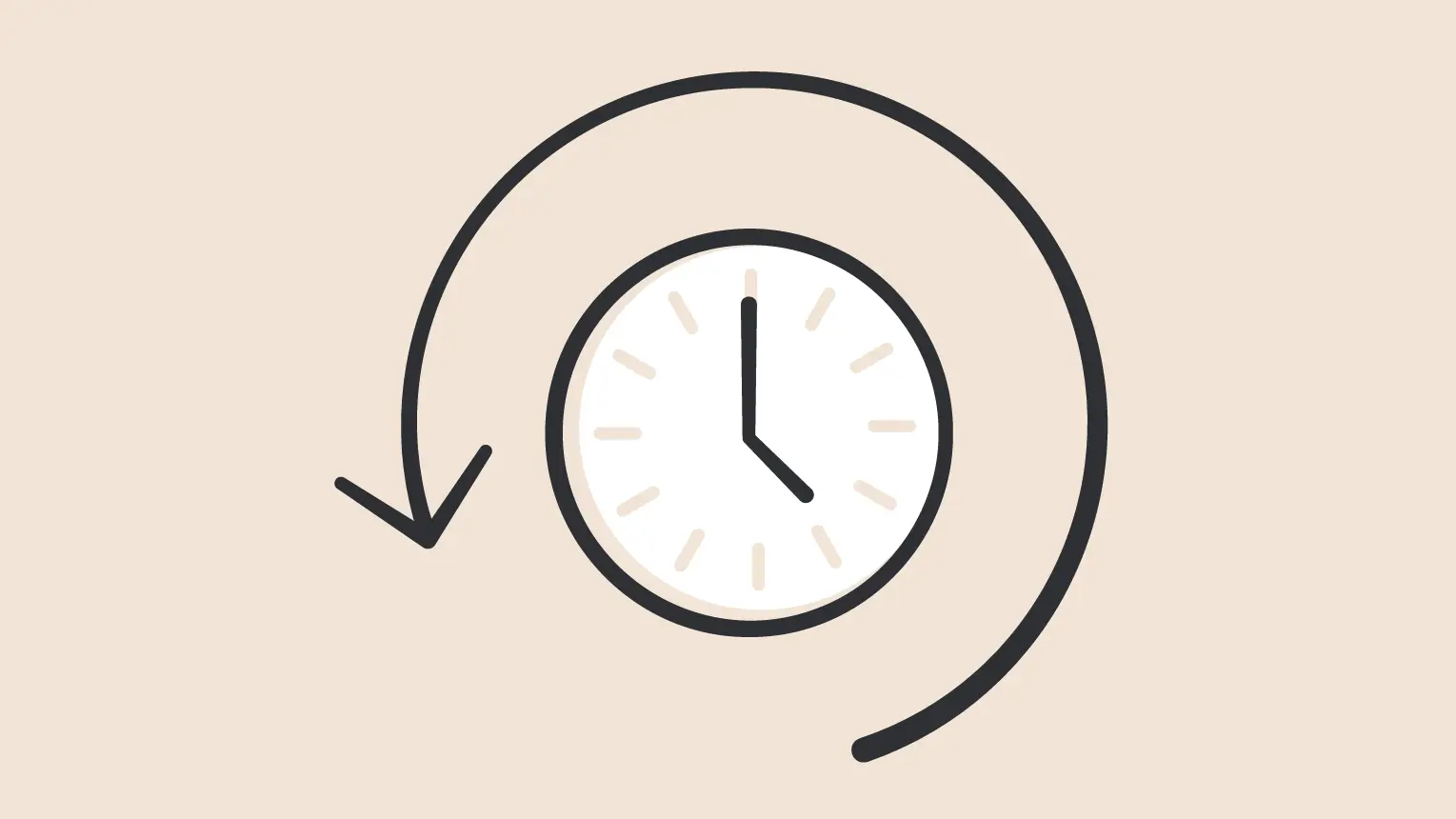
Von der Treuhand bis zum Einigungsvertrag - in dem halben Jahr ihres Bestehens stellte die erste frei gewählte Volkskammer der DDR wichtige Weichen für die Zukunft.

Vor 35 Jahren trat die erste frei gewählte DDR-Volkskammer zusammen. Innerhalb von sechs Monaten entschieden die Volksvertreter über die deutsche Vereinigung.

Die Journalistin Cerstin Gammelin präsentiert mit "Die Unterschätzten" ein exzellentes Buch über die Wiedervereinigung aus der Perspektive einer Ostdeutschen.
