Neue Ausstellung eröffnet : Eine Erfolgsgeschichte mit Schattenseiten
Rund 220.000 Juden kamen als Kontingentflüchtlinge nach Deutschland. Die Ausstellung "Gesetz zum Leben" im Bundestag zeigt ihre Geschichten.
Als Irina Agibla Anfang 2000 im ukrainischen Dnipro in den Zug steigt, fühlt es sich für die damals 34-Jährige so an, als würde sie ein Stück von ihr für immer zurücklassen. Über Kiew ist Agibla schließlich nach Berlin gekommen - als sogenannter Kontingentflüchtling.
Per Gesetz hat es die Bundesrepublik damals Jüdinnen und Juden aus der ehemaligen Sowjetunion ermöglicht, in Deutschland ein neues Leben zu beginnen. Die Regelung galt von 1991 bis Ende 2004. Insgesamt rund 220.000 Menschen haben diese Möglichkeit genutzt.

Die Werke von Era Freidzon sind Teil der Ausstellung „Gesetz zum Leben“ im Paul-Löbe-Haus des Bundestages. In ihrer Kunst widmet Freidzon sich der Geschichte von Kontingentflüchtlingen.
Welche Beweggründe sie hatten, wie es ihnen in der neuen Heimat ergangen ist und welchen Einfluss sie bis heute auf das jüdische Leben in der Bundesrepublik haben, davon erzählt die Ausstellung "Gesetz zum Leben - wie jüdische Kontingentflüchtlinge in Deutschland ankamen", die seit dieser Woche im Paul-Löbe-Haus zu sehen ist.
Die Entscheidung, nach Deutschland zu gehen, sei ihr nicht leicht gefallen, erzählt Agibla. Die Unsicherheit vor dem Unbekannten und auch eine starke Bindung an Zuhause hätten sie ebenso zögern lassen wie die Frage, ob sie in der Bundesrepublik weiter ihren Beruf ausüben könne. Doch ihr Leben in der ehemaligen Sowjetunion weiterzuführen, sei schlichtweg keine Alternative gewesen: "Jederzeit konnte man alles verlieren. Man war ohne Schutz".
Bundestagspräsidentin Klöckner spricht von “Erfolgsgeschichte”
An einer interaktiven Station kommen die Kontingentflüchtlinge selbst zu Wort. Wie Agibla sprechen die meisten in ihrer Muttersprache, die Interviews sind deutsch untertitelt. Neben Informationstafeln setzt die Ausstellung darauf, persönliche Geschichten zu transportieren.
In einer Vitrine sind Gegenstände der Geflüchteten ausgestellt, die Künstlerin und Kuratorin Era Freidzon verarbeitet in ihren Werken die Geschichte, Erfahrungen und Gedanken dieser Einwanderdergruppe.
Doch auch die politische Komponente des Gesetzes wird in der Ausstellung thematisiert. Durch Videos und Audiospuren können Besucher die historischen Bundestagsdebatten zum sogenannten Kontingentflüchtlingsgesetz nachverfolgen.
Das Gesetz sei damals eine "schnelle und pragmatische Lösung" gewesen, sagte Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) bei der Ausstellungseröffnung am Dienstagabend im Paul-Löbe-Haus. Es sei "eine Erfolgsgeschichte". Die Einwanderer von damals, ihre Kinder und Enkelkinder würden heute "das Rückgrat" der jüdischen Gemeinden bilden.
Vielen Kontingentsflüchtlingen der ersten Generation droht Altersarmut
Die Ausstellung gibt detaillierte Einblicke, wie sich die jüdischen Gemeinden seit 1990 verändert haben. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs waren die meisten Synagogen zerstört, nur wenige ausgewanderte Juden kamen zurück. Erst mit dem Zuzug der Kontingentflüchtlinge entwickelte sich in Deutschland wieder eine dynamische jüdische Gemeinschaft, 30 neue Synagogen sind seitdem entstanden. Mittlerweile seien jüdische Gemeinden zu rund 80 Prozent von Kontingentflüchtlingen geprägt, sagte Mark Dainow, Vizepräsident des Zentralrats der Juden, bei der Eröffnung.
Er sieht in der Integration der Geflüchteten ebenfalls einen Erfolg. Jedoch müssten auch die Schattenseiten beleuchtet werden. Insbesondere viele Geflüchteten der ersten Generation hätten Probleme damit gehabt, Abschlüsse anerkannt zu bekommen und ihre gelernten Berufe wieder aufzunehmen: "Einige haben Zeit ihres Erwerbslebens nicht in ihren angestammten Beruf arbeiten können." Dieser Fehler müsste die Politik antreiben, es besser zu machen, doch noch immer hätten es eingewanderte Fachkräfte, jüdische wie nicht-jüdische, schwer bei der Berufsanerkennung.
„Wir können nicht zulassen, dass Juden unser Land wieder verlassen, weil sie angefeindet werden.“
Vielen Kontingentflüchtlinge der ersten Generation drohe heute die Altersarmut, ergänzte Aaron Schuster von der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland in einem anschließenden Podiumsgespräch. Es brauche daher eine Neuaufsetzung des Härtefallfonds für Kontingentflüchtlinge, forderte er. Von Anfang 2023 bis Ende Januar 2024 konnten Betroffene einen Antrag auf eine pauschale Einmalzahlung stellen. Die Bewilligungsquoten sind laut Schuster gut gewesen.
Neben der Altersarmut und Integrationsschwierigkeiten thematisiert die Ausstellung einen weiteren Aspekt, der für viele Geflüchtete eine große Rolle spielt: den 7. Oktober 2023. Das Massaker der Hamas in Israel und der weltweit erstarkende Antisemitismus bereitet in Deutschland vielen Jüdinnen und Juden Sorge. "Wir können nicht zulassen, dass Juden unser Land wieder verlassen, weil sie angefeindet werden", mahnte Bundestagspräsidentin Klöckner.
Die Ausstellung ist noch bis zum bis zum 10. Dezember 2025 in der Halle des Paul-Löbe-Hauses zu sehen. Sie kann montags bis freitags nach vorheriger Anmeldung von 9 bis 17 Uhr besucht werden.
Mehr zum jüdischen Leben in Deutschland

78 Jahre nach Kriegsende ist die jüdische Gemeinschaft in Deutschland die drittgrößte in Europa. Was an jüdischem Leben aufgebaut wurde, ist nun wieder in Gefahr.
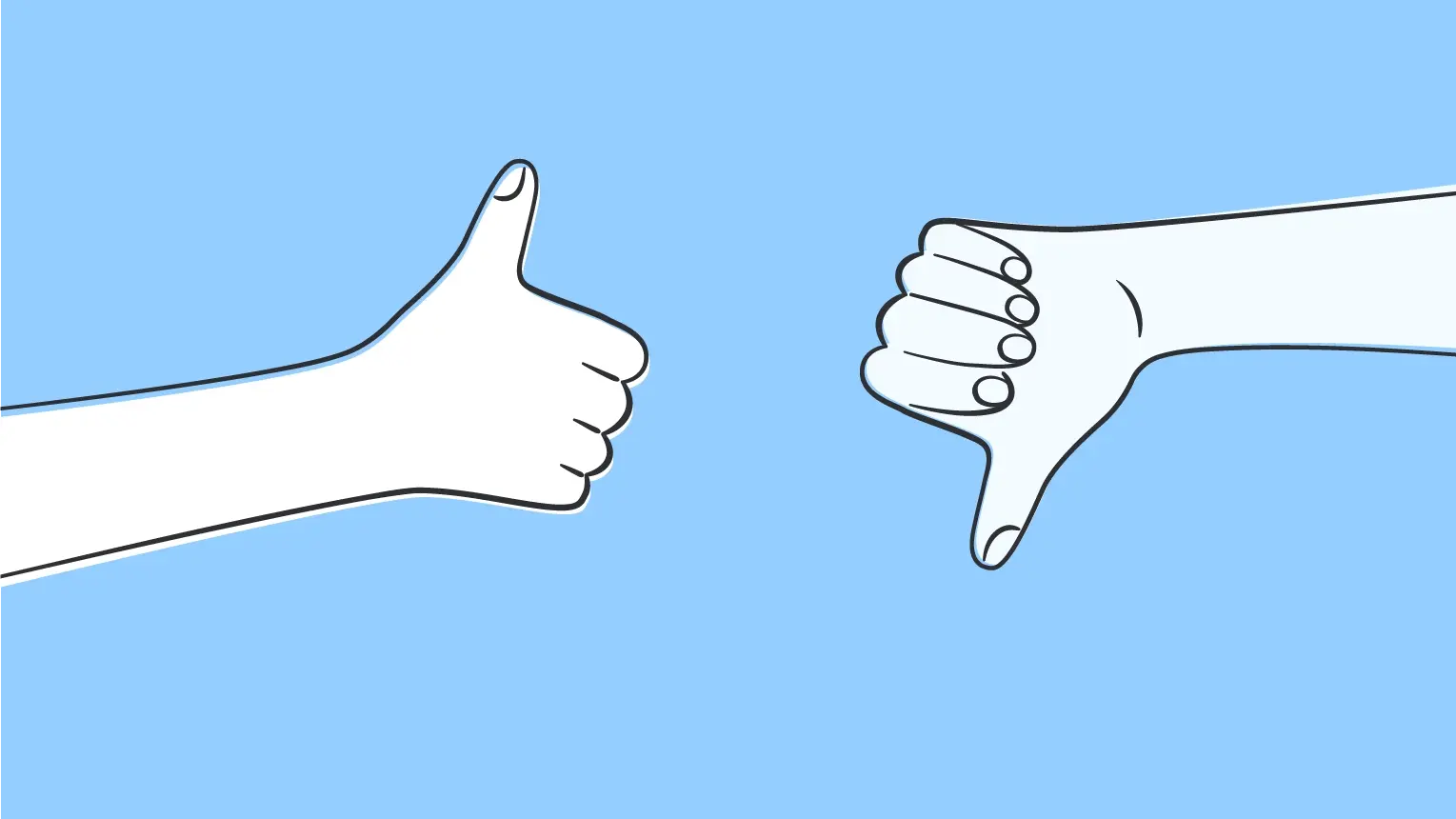
Findet jüdisches Leben in Deutschland ausreichend Unterstützung? Für Markus Decker lässt die Politik daran großteils keine Zweifel, Hagen Strauß wünscht sich mehr.

Nach dem Terrorangriff der Hamas fordert der Chefredakteur der „Jüdischen Allgemeinen“, Philipp Peyman Engel, die offensive Bekämpfung von Judenhass in Deutschland.






