
Mission Ausland : Von der Bündnisverteidigung zum Kampf gegen den Terror
Die Bundeswehr schickt seit 65 Jahren Soldatinnen und Soldaten in Auslandseinsätze. Vor allem die militärische Mission in Afghanistan hat die Truppe geprägt.
Um 23:42 Uhr bebt am 29. Februar 1960 die Erde im marokkanischen Agadir. Gebäude stürzen ein, 15.000 Menschen sterben, 12.000 werden verletzt. Marokko braucht dringend schnelle Hilfe. Auf die Folgen einer so schweren Naturkatastrophe ist das Land nicht vorbereitet. Und so beginnt für die Bundeswehr ihr erster richtiger Auslandseinsatz: 102 Soldaten, darunter sechs Ärzte, zwei Apotheker und 47 Sanitäter, zehn ABC-Abwehrspezialisten sowie 16 Fernmelder von der Marine, bauen in Agadir einen Feldverbandsplatz auf.
Seit nicht einmal fünf Jahren gibt es die westdeutschen Streitkräfte zu diesem Zeitpunkt. Ihre Hauptaufgabe ist die Landes- und Bündnisverteidigung. Nun kommt ein weiterer Auftrag hinzu: humanitäre Missionen. Die Bundeswehr übernimmt zwischen 1959 und 1991 gut 135 Hilfseinsätze im Ausland. Wie gefährlich solche Operationen sein können, zeigt eine Mission in Kambodscha, die für die Truppe 1991 beginnt. In Phnom Penh betreibt sie ein Krankenhaus. Dort stirbt der erste Soldat der Bundeswehr im Auslandseinsatz: Am 14. Oktober 1993 wird der 26-jährige Feldwebel Alexander Arndt von Räubern ermordet.
Missionen im Ausland bekommen für die Bundeswehr nach der Wiedervereinigung eine immer höhere Priorität. Denn mit dem Ende des Kalten Krieges verliert die Landesverteidigung an Bedeutung. Deutschland sieht sich umgeben von Freunden.
Bundeswehreinsätze auf dem Balkan lösen gesellschaftliche Debatte aus
Gleichzeitig werden die Zeiten konfliktreicher. Als Anfang der 1990er-Jahre Jugoslawien zerbricht, kommt es in Europa zu mehreren Kriegen. Am 25. Juni 1991 erklären sich Slowenien und Kroatien für unabhängig. Die Regierung in Belgrad versucht, das mit Gewalt zu verhindern. In Bosnien-Herzegowina, wo Kroaten, muslimische Bosniaken und Serben leben, beginnt ein Bürgerkrieg, der von allen Seiten brutal geführt wird. Die Bundeswehr unterstützt die Vereinten Nationen (UN), die für Frieden sorgen wollen, fliegt mit ihren Transall-Maschinen Hilfsmissionen in das Kriegsgebiet, auch in das belagerte Sarajewo. Als die Lage in dem Bürgerkriegsland immer schlimmer wird, beginnt die Nato die Operation "Deny Flight". Kampfflugzeuge setzen eine Flugverbotszone der UN durch, um Zivilisten vor Luftschlägen zu schützen. Sie attackieren auch Geschütze der bosnischen Serben. Deutschland nimmt mit mehr als 480 Soldaten und 14 Jagdbombern vom Typ Tornado an der Operation teil.
Aus der Bundeswehr wird nach und nach eine Kriseninterventionsarmee. In immer mehr Auslandseinsätze werden die Streitkräfte entsendet, auch bewaffnet, wie erstmals 1993 nach Somalia. Ob das Grundgesetz solche Einsätze außerhalb des Nato-Bündnisgebiets deckt, ist allerdings innenpolitisch umstritten. 1994 urteilt das Bundesverfassungsgericht, "Out of area"-Einsätze seien verfassungskonform, wenn der Bundestag vorher zustimmt.
Wer entscheidet über Auslandseinsätze?
📙 Ob das Grundgesetz Bundeswehreinsätze außerhalb des Nato-Bündnisgebiets überhaupt zulässt, darüber wurde unmittelbar nach der Wiedervereinigung kontrovers diskutiert. Der Bundestag hatte 1990 in der Debatte um die militärische Beteiligung an UN-Sanktionen gegen die Besetzung Kuwaits durch Irak über diese Frage heftig gestritten.
👩🎓 Das Bundesverfassungsgericht, angerufen von den FDP- und SPD-Bundestagsfraktionen wegen Bundeswehreinsätzen im früheren Jugoslawien und Somalia, kam schließlich am 12. Juli 1994, zu einem Urteil: Militärische Auslandsmissionen der Bundeswehr zur Umsetzung von UN- und Nato-Beschlüssen sind demnach verfassungskonform, wenn der Bundestag zuvor zugestimmt habe. Der Parlamentsvorbehalt wurde damit verankert.
Ein Jahr später billigt das Parlament den Einsatz der Bundeswehr in Bosnien-Herzegowina als Teil der internationalen Schutztruppe am Boden, die das Einhalten einer Waffenruhe zwischen den Bürgerkriegsparteien absichern soll. Und 1999 nehmen deutsche Tornado-Jets an Luftangriffen auf Serbien teil. Die Bundeswehr unterstützt dort dann auch die Schutztruppe KFOR für den Kosovo.
Nach dem 11. September beteiligt sich die Bundeswehr am Kampf gegen den Terror
Zwei Jahre später verändert der 11. September 2001 die Welt. Islamistische Terroristen der al-Qaida greifen die USA an, lenken Passagierflugzeuge in das World Trade Center in New York City und in das Pentagon bei Washington. Die Nato erklärt daraufhin erstmals und bisher einmalig den Bündnisfall. Als die USA in den Krieg gegen den Terror ziehen, beteiligt sich die Bundeswehr. Mehr als 20 Jahre lang wird das zu ihrer Hauptaufgabe.
Da die Taliban in Afghanistan den Terroristen der al-Qaida Unterschlupf bieten, greifen die USA dort an. Und die Bundeswehr ist dabei. Der Bundestag stimmt zunächst dem Einsatz von Spezialeinheiten im Rahmen der "Operation Enduring Freedom" und dann einem stetig größer werdenden Engagement der "Parlamentsarmee" für die "Internationale Sicherheitsunterstützungstruppe" (ISAF) zu.
„Die damaligen Entscheidungen für einen weitreichenden Um- und Rückbau der Bundeswehr wirken sich bis heute auf ihren Zustand aus.“
Für die Streitkräfte führen die Missionen im "War on terror" zu einem systematischen Umbau. Leichte Kräfte stehen nunmehr im Vordergrund, also Fallschirmjäger und Jäger beim Heer – die in Flugzeugen und Hubschraubern schnell verlegt werden können und gegen Terroristen und Aufständische vorgehen sollen. Bei der Marine bekommen Kriegsschiffe Vorrang, die lange in ausländischen Gewässern bleiben können und für eine Vielzahl von Aufträgen geeignet sind wie Fregatten und Korvetten. Die Schnellboote, die sich vor allem für die Ostsee eignen, werden aussortiert.
Da Kampfpanzer und andere schwere Waffen am Hindukusch und später in Mali, einem weiteren großen Auslandseinsatz der Bundeswehr, keine Rolle spielen, werden die für die Landesverteidigung benötigten Truppenteile, die bei „Out-of-area-Missionen“ keine Rolle spielen, zusammengestrichen. Die Panzertruppe, die im Kalten Krieg noch mehr als 3.000 Kampfpanzer hatte, schrumpft, soll nur noch 225 Leopard 2 behalten. Und die Heeresflugabwehr, der Schutz eigener Kräfte vor Luftangriffen, wird aufgelöst. Der Bundesrechnungshof stellt 2025 in einem Bericht im Rückblick fest: „Die damaligen Entscheidungen für einen weitreichenden Um- und Rückbau der Bundeswehr wirken sich bis heute auf ihren Zustand aus.“
Der 20-jährige Afghanistan-Einsatz ist der opferreichste
In Afghanistan operieren deutsche Soldaten zunächst nur in der Hauptstadt Kabul, dann wird ihr Einsatzgebiet auf den Norden des Landes ausgeweitet. Die Sicherheitslage verschlechtert sich trotz des großen Einsatzes bald. Erstmals seit 1945 kämpfen und sterben deutsche Soldaten in schweren Gefechten. Bei Anschlägen, Angriffen und Unfällen kommen 59 Bundeswehrangehörige am Hindukusch ums Leben. Der Auslandseinsatz in Afghanistan endet 2021 - nach 20 Jahren. Als Erfolg gilt die Mission trotz aller Opfer nicht: Die radikalislamischen Taliban herrschen heute über das gesamte Land.
Mit dem russischen Angriff auf die Ukraine 2022 verschieben sich die Aufgaben für die Truppe. Die Missionen in Afghanistan und Mali sind Geschichte. Im Ausland sind aber immer noch viele deutsche Soldatinnen und Soldaten aktiv: Weiterhin helfen sie etwa, den brüchigen Frieden im Kosovo zu erhalten. Und in Litauen stellt die Bundeswehr erstmals eine Brigade auf, die dauerhaft außerhalb der eigenen Landesgrenzen stationiert wird.
Mit der Zeitenwende kehrt die Bundeswehr zum Gründungauftrag zurück
Die vielfach beschriebene Zeitenwende hat auch die Auslandsmissionen der Truppe verändert. Sie sollen nun nicht mehr humanitäre Hilfe leisten wie in Agadir oder Einsatzgebiete stabilisieren wie in Afghanistan, sondern zur militärischen Abschreckung beitragen. Für die Bundeswehr bedeutet das eine Rückkehr zu ihrem Auftrag aus Gründungstagen: Sie sollte von Anfang an dabei helfen, das demokratische Europa zu verteidigen.
Der Autor ist sicherheitspolitischer Korrespondent von "Die Zeit" und “Zeit Online”.
Mehr zur Bundeswehr
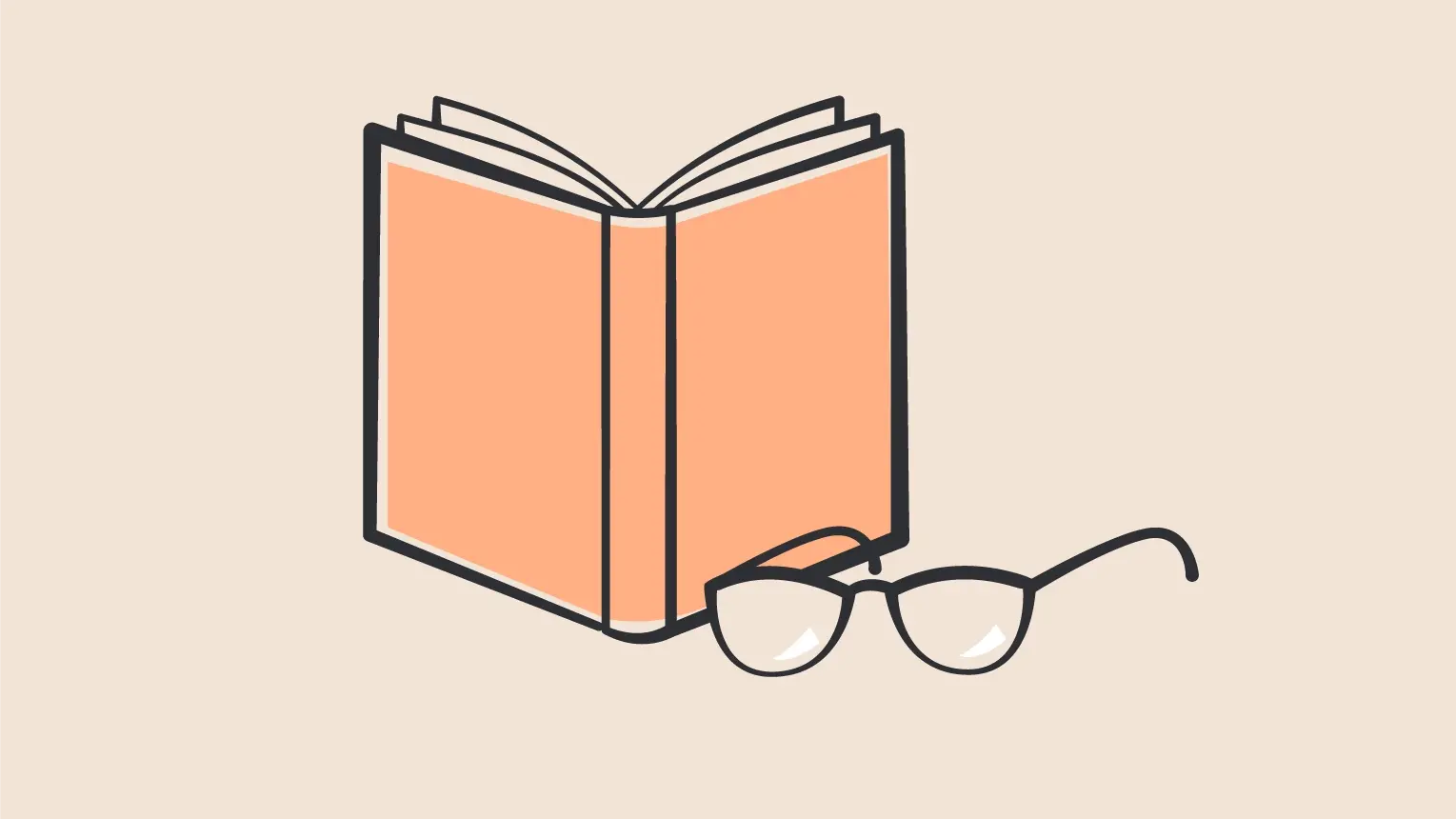
Der Militärhistoriker Sönke Neitzel blickt in seinem neuen Buch zurück auf 70 Jahre Bundeswehr. Und er fordert ein Umdenken in der Verteidigungspolitik.

Noch 1962 fehlte der Bundeswehr Personal und Ausrüstung, doch ab Mitte der 1970er Jahre galt sie als die stärkste konventionelle Armee Europas.

Der Aufbau der neuen deutschen Panzerbrigade 45 in Litauen geht zügig voran. Bis 2027 soll sie "kriegstüchtig" sein. Ein Besuch vor Ort.