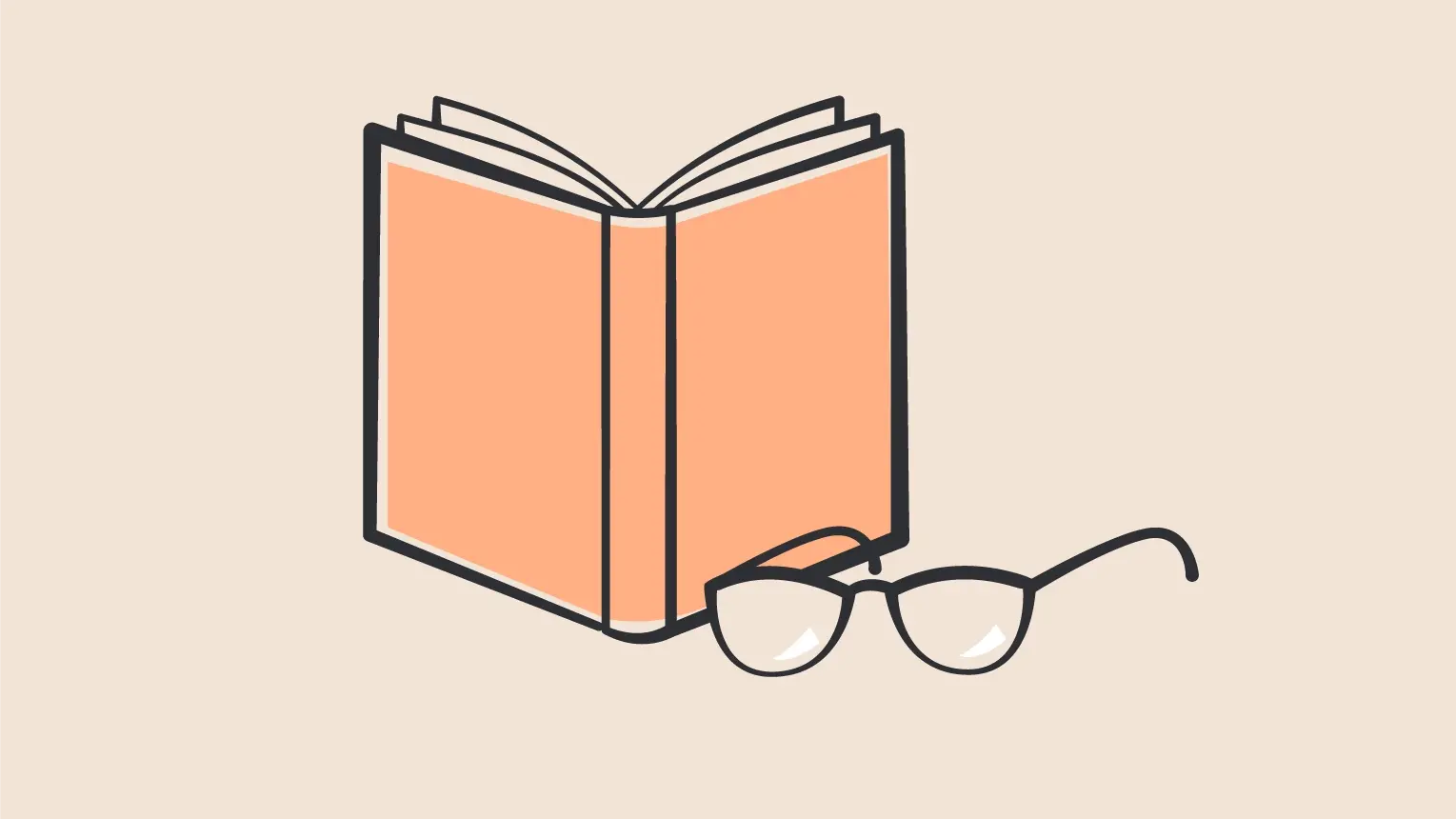Die Bundeswehr im Kalten Krieg : "Bedingt abwehrbereit"
Noch 1962 fehlte der Bundeswehr Personal und Ausrüstung, doch ab Mitte der 1970er Jahre galt sie als die stärkste konventionelle Armee Europas.
Desaströs - anders konnte man das Urteil nicht nennen: Nur "für kurze Zeit zur Abwehr bedingt geeignet" sei die Bundeswehr, urteilte die Nato nach dem Stabsmanöver "Fallex 62". Aus dem geheimen Votum machte der "Spiegel" unter der Überschrift "Bedingt abwehrbereit" eine 16 Seiten lange Titelgeschichte, deren Veröffentlichung am 9. Oktober 1962 eine schwere politische Krise auslöste. Ganz gleich, ob es sich nun um einen "Abgrund von Landesverrat" - so Bundeskanzler Konrad Adenauer (CDU) im Bundestag - handelte oder nicht: Sachlich traf die Schlagzeile zu.
Bundeswehr konnte 1962 keine der von der Nato gestellten Aufgaben erfüllen
Laut Nato-Planung sollte die westdeutsche Armee rund 40 Prozent der Bodentruppen für die Verteidigung Mitteleuropas stellen sowie 25 Prozent der Kampfflugzeuge. Die damalige Bundesmarine sollte die Ostsee kontrollieren und im Falle eines Angriffs des Ostblocks eine Invasion ermöglichen.

Soldaten bei der Pilotenausbildung im Jahr 1981 vor Tornado-Kampfflugzeugen der Bundeswehr auf dem Flugfeld der britischen Luftwaffenschule in Oakham.
Im Herbst 1962 konnte die Bundeswehr keine dieser Aufgaben erfüllen. So standen statt der im Verteidigungsfall durch 655.000 ausgebildete Reservisten ergänzten Friedensstärke von 495.000 Soldaten knapp 400.000 aktive Soldaten und etwa gleich viele Reservisten zur Verfügung. Sieben Jahre nach ihrer Gründung verfügte die Bundeswehr also nur über zwei Drittel des geplanten Personals. Ferner mangelte es an modernen Waffen, hinreichend Munition sowie Logistik. Erst 1971 erreichte die Masse der Bundeswehr-Verbände laut Nato-Bewertung einen "hohen Einsatzwert bei nur noch geringfügigen Mängeln". Ab 1975 galt die westdeutsche Armee dann als voll einsatzfähig.
Der schleppende Aufbau der Bundeswehr hatte verschiedene Gründe: Erstens war das vormalige "Dritte Reich" nach der Niederlage 1945 weitgehend demilitarisiert worden. Als Anfang der 1950er Jahre die Ost-West-Konfrontation ein Umschlagen des Kalten Krieges in einen "heißen" Kampf wahrscheinlicher scheinen ließ, nutzte die Regierung zweitens den geforderten Wehrbeitrag Westdeutschlands als Hebel, um schneller souverän zu werden: Politische Kriterien standen im Vordergrund, nicht die konkreten militärischen Bedürfnisse der Soldaten. Drittens herrschte erheblicher Widerwille in der Gesellschaft: Zeitweise mobilisierte die pazifistische "Ohne-Mich"-Bewegung bis zu sechs Millionen Bürger gegen die Wiederbewaffnung; erst ab 1957 sah die Mehrheit der Bevölkerung die Bundeswehr positiv.
Erst mit dem Panzer Leopard kam die zeitgemäße Ausstattung
Schließlich bestand die Erstausstattung der westdeutschen Armee zum großen Teil aus ausgemusterten Waffen der US Army sowie aus Wehrmachts-Restbeständen. Die erste große Eigenentwicklung, der Schützenpanzer HS-30, erwies sich als Millionengrab; das teuerste Rüstungsprojekt seiner Zeit, die deutsche Version des US-Jägers Starfighter, kostete im Laufe der Zeit mehr als hundert Piloten das Leben.
Erst mit dem 1965 eingeführten Panzer Leopard und seinen Weiterentwicklungen erhielt das Heer eine zeitgemäße Ausstattung. Bei der Luftwaffe ergänzte die Phantom II ab 1971 den Starfighter, den seit 1980 der europäische Kampfjet Tornado ablöste. Die Bundesmarine bekam Mitte der 1960er Jahre die ersten neuen, teilweise noch in den USA gebauten Zerstörer sowie selbst entwickelte U-Boote. Einen Sonderstatus hatten Trägersysteme der Bundeswehr für US-Kernwaffen wie die Pershing I und spezielle Versionen der Düsenjäger: Damit wurde das Prinzip der "nuklearen Teilhabe" der Bundesrepublik umgesetzt.
Mit zu wenig Geld hatte die lange Dauer bis zur vollen Einsatzfähigkeit der Bundeswehr jedoch nichts zu tun. Laut Daten des Stockholm International Peace Research Institute steckte die Bundesrepublik von 1955 bis 1967 jedes Jahr effektiv rund vier Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BiP) in die Verteidigung. Weil die Wirtschaftskraft in dieser Zeit bei durchschnittlich mäßiger Inflation stark zulegte, ergab sich eine Steigerung von 5,2 auf knapp 20 Milliarden D-Mark; mehrfach konnten diese Mittel gar nicht vollständig ausgegeben werden.
Ab 1968 sank dann der Anteil der Verteidigungsausgaben am BIP kontinuierlich, bis auf 2,5 Prozent 1990. Die tatsächlichen Ausgaben stiegen aber immer noch, von gut 18 auf 54,5 Milliarden D-Mark. Erst nach dem Ende des Kalten Krieges sank der Anteil unter zwei Prozent, bis auf ein Minimum von 1,12 Prozent des BIP 2015; seither steigen die Ausgaben wieder. Investitionen in die militärische Sicherheit allerdings wirken erst, das zeigt der Blick auf die Geschichte der Bundeswehr, nach fünf bis 15 Jahren.
Der Autor ist Leitender Redakteur im Ressort Geschichte der "Welt" in Berlin.
Mehr zur Bundeswehr lesen

Etwas Ähnliches hat es nie zuvor gegeben: Aus Bundeswehr und DDR-Volksarmee wurde mit dem 3. Oktober 1990 eine Truppe. Ein komplizierter Übergangsprozess begann.

Die Rechtswissenschaftlerin Kathrin Groh erklärt, welche Pflichten möglich wären – und was das Grundgesetz zu einer allgemeinen Dienstpflicht sagt.

Die Bundeswehr schickt seit 65 Jahren Soldatinnen und Soldaten in Auslandseinsätze. Vor allem die militärische Mission in Afghanistan hat die Truppe geprägt.