
Pflegerat-Präsidentin Vogler : "Wir haben noch immer zu wenig Personal"
Die Pflegeversicherung steht finanziell unter Druck, in der Versorgung fehlen nach wie vor Fachkräfte. Der Deutsche Pflegerat macht sich für Reformen stark.
Frau Vogler, unlängst ist die Pflegeversicherung mit Blick auf die Finanzlage als "Notfallpatient" dargestellt worden. Wie schätzen Sie die aktuelle Lage ein?
Christine Vogler: Es ist ernst, aber eine Pflegekasse kann faktisch nicht in Konkurs gehen. Wir müssen aktuell nicht damit rechnen, dass plötzlich kein Geld mehr gezahlt wird. Es gibt jedoch in der Pflegeversicherung eine finanzielle Schieflage. Die Ausgaben sind enorm gestiegen. Grundsätzlich muss die Finanzierung der Gesundheitsversorgung zukunftssicher geklärt werden. Das beinhaltet den Blick auf alle Versorgungsgebiete, auch die der Pflege.
Was sollte sich bei der Finanzierung der Pflege ändern?
Christine Vogler: Wir werden in Zukunft mehr differenzieren müssen. Dies vor allem mit Blick auf die vorhandenen und notwendigen Bedarfe in der Bevölkerung und auf die Pflegeversicherung selbst. Wir müssen uns auf den Kern dieser konzentrieren, also auf die pflegerelevanten Themen. Aber auch in der Frage, mit welchen der Leistungen tatsächlich die Zielsetzungen der Pflegeversicherung umgesetzt werden. Die Leistungserweiterungen der letzten Jahre müssen präzise untersucht werden.
Der Pflegegrad 1 ist derzeit in der Diskussion. Dieser ist als Zugang zur pflegerischen Versorgung gedacht und nach wie vor wichtig – auch um schwerere Pflegebedürftigkeit zu vermeiden oder aufzuhalten. Wir müssen uns die Angebote ansehen, die nicht direkt mit der Pflege zu tun haben, wie zum Beispiel die Organisation des heimischen Haushalts.
Doppelstrukturen können vermieden werden, wenn die Profession Pflege mehr Handlungskompetenzen bekommt. Das spart auch Geld. Und wir müssen über die Herausnahme von versicherungsfremden Leistungen aus der Pflegeversicherung und über die Übernahme der Investitionskosten durch die Länder, wie es im SGB XI vorgesehen ist, sprechen.

In der Pflege hat es in den vergangenen Jahren zahlreiche Veränderungen gegeben: zusätzliche Leistungen, eine umfassende Ausbildungsreform und mehr Geld für Pflegekräfte. Sind damit die Probleme in der Versorgung nicht weitgehend gelöst?
Christine Vogler: Wir haben Verbesserungen im System, was nicht heißt, dass alles gut ist. Die Löhne sind dank der Tariftreueregelung seit 2022 vor allem in der Langzeitpflege zurecht gestiegen. Die Pflegepersonaluntergrenzen und die Pflegepersonalregelung (PPR 2.0) im Krankenhausbereich sowie das Personalbemessungsverfahren in der stationären Langzeitpflege sichern Arbeitsstrukturen und Arbeitszufriedenheit, die dann wiederum die Pflegenden im Beruf halten. Das ist ja eine Zielsetzung. Insgesamt muss sich die quantitative und qualitative Personalsituation im Alltag jedoch stärker an den Erfordernissen der Patienten und Pflegebedürftigen orientieren, und sie muss unter der Einhaltung von Mindeststandards flexibel gestaltbar sein.
Insgesamt haben wir nach wie vor noch immer zu wenig Personal und teilweise auch nicht in der richtigen Qualifikation. Es gibt Einrichtungen mit ausreichend Personal, das hängt dann natürlich auch mit den konkreten Arbeitsbedingungen dort zusammen.
„In anderen Ländern wird den Gesundheitsberufen eine überragende Bedeutung zugemessen. In Deutschland gibt es nicht einmal eine Fortbildungs- und Registrierungspflicht in der Pflege.“
Wie schätzen Sie die Zusammenarbeit von Pflegern und Ärzten im Versorgungsalltag ein?
Christine Vogler: Die Pflege ist in unserem Gesundheitssystem eine häufig ungenutzte Ressource. Ob in der ambulanten Versorgung, in der Langzeitpflege oder im Krankenhaus: Pflegekräfte dürfen im Moment offiziell viele Dinge nicht selbstständig ausüben, die sie gelernt haben, auch wenn sie es vielfach dennoch tun. Ärzte bestimmen, ob man eine Verordnung bekommt oder nicht, ob man krank oder gesund ist. Das ist das Alleinstellungsmerkmal des Arztes in Deutschland.
In anderen Ländern werden die Versorgungssituation und die Gesundheitseinschätzung in einer Arbeitsteilung von Ärzten, Therapieberufen und Pflegekräften geregelt. Das fehlt bei uns. Wenn beispielsweise in der ambulanten Pflegeversorgung doppelte Wege vermieden würden, indem Pflegekräfte selbstständig Verordnungen in bestimmten Bereichen vornehmen könnten, dann würden wir viel Zeit und Geld sparen. Durch eine erweiterte Handlungskompetenz der Pflegekräfte können auch die immer noch starren Hierarchien abgebaut werden.
Viele unzufriedene oder ausgelaugte Fachkräfte scheiden vorzeitig aus ihrem Beruf aus. Ein Grund ist mangelnde Wertschätzung, weil Pflegefachkräfte bestimmte Aufgaben nicht übernehmen dürfen, für die sie qualifiziert sind. Kann das geplante Gesetz zur Befugniserweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege diesen Makel ausgleichen?
Christine Vogler: Der Gesetzentwurf ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung und eine enorme Chance. Dabei muss es auch um eine Neuorientierung der Kompetenzen der Gesundheitsfachberufe insgesamt gehen. Ausgangspunkt muss dabei sein, wer die Bedarfe der Patient:innen oder der Pflegebedürftigen mit seinem Know-how am besten decken kann. Dabei hat jeder Gesundheitsfachberuf seinen Beitrag zu leisten, Ärzte, Therapeuten, Logopäden und die Pflege. Die verschiedenen Professionen müssen besser miteinander verknüpft werden. In diesem Gesetz wird dem Pflegeberuf erstmals eine eigene Handlungskompetenz eingeräumt. Das ist wichtig. Pflegefachpersonen sollen demnach nicht mehr nur auf amtliche Anordnungen hin aktiv werden, sondern im Rahmen ihrer Kompetenz wesentlich häufiger selbstständig Entscheidungen treffen können. Das kann dazu beitragen, dass die berufliche Wertschätzung der Pflegekräfte gestärkt wird. Zur Wertschätzung gehört aber auch das Mitspracherecht in einer Einrichtung und im System der Selbstverwaltung. Dazu müssen Strukturen noch verändert werden.
Laut dem vorliegenden Gesetzentwurf sollen Pflegekräfte je nach Qualifikation eigenständig bei Diabetes-Patienten, der Wundheilung und bei Demenz über die Versorgung entscheiden dürfen. Sind das die Kernpunkte, um die es geht?
Christine Vogler: Ja, das ist ein Start. Hier liegen klare Kompetenzen in der Pflege. Die pflegerische Einschätzung der Situation eines Patienten in seiner Häuslichkeit oder auch in der Klinik geht jedoch weit über diese Erkrankungen hinaus. Wir sind aber froh, dass wir erst einmal diese Module haben, die einen Handlungsrahmen vorgeben, auch einen Qualifikationsrahmen für die Pflegefachpersonen. Das ist für uns aber nur der Anfang. Das Ziel muss sein, mit dem im Gesetz ebenfalls vorgesehenen "Muster-Scope of Practice", also der geplanten Beschreibung dessen, was Pflegefachpersonen können und machen dürfen, einen Kompetenzbereich unabhängig von Modulen zu definieren.
Dabei geht es zum Beispiel um eine Schmerzbetreuung, egal aus welchem Krankheitsbild heraus sie resultiert, oder um eine Wundversorgung mit der Kompetenz, Wunden generell einschätzen zu können. Es geht aber auch darum, Versorgungssituationen von Pflegepatienten zu beurteilen, etwa bezüglich der benötigten Hilfsmittel oder der Einstufung in einen Pflegegrad. Das sind alles Dinge, die wir uns als Pflege wünschen selbst- und eigenständig übernehmen zu dürfen.
Das macht der Deutsche Pflegerat
👉 Der Deutsche Pflegerat e.V. wurde 1998 gegründet, um Positionen der Pflegeorganisationen einheitlich zu vertreten, deren politische Arbeit zu koordinieren und die Interessen der professionellen Pflegekräfte zu vertreten. Der Dachverband vertritt heute nach eigenen Angaben 1,7 Millionen beruflich Pflegende auf Bundesebene.
👉 Ursprünglich bestand der Deutsche Pflegerat aus fünf Verbänden. In den ersten Jahren wuchs die Zahl der Mitgliedsverbände auf elf an. Später schlossen sich auch die Hebammen dem Dachverband an.
👉 Der Verband beteiligt sich in Arbeitsgruppen im Bundesgesundheitsministerium, der Gesundheitsministerkonferenz oder auch der Bundesärztekammer. Der DPR wird auch in Gremien zur Qualitätssicherung berufen.
👉 Seit 2014 organisiert der DPR jedes Jahr den Deutschen Pflegetag, die zentrale Veranstaltung für beruflich Pflegende in Deutschland.
Welche Rolle spielt in dem Zusammenhang die relativ neue Akademisierung des Pflegeberufs?
Christine Vogler: Nur für Deutschland ist dieses Studium neu. Weltweit ist die Pflege meist ein Bachelor-Studium. Wir haben angesichts der Bedarfe heute generell neue, andere und gestiegene Anforderungen an unser tägliches pflegerisches Handeln als noch vor zehn Jahren. Dem müssen sich unsere Ausbildungs- und Weiterbildungsinhalte und -strukturen wie auch unsere hochschulischen Bildungsinhalte kontinuierlich anpassen, um eine zukunftsorientierte Versorgung zu sichern. Wir benötigen daher neue Bildungsformen, so wie sie international auch üblich sind. Weiter brauchen wir in der Pflege verschiedene Bildungsinhalte, um die Versorgung zu stemmen: Pflegefachassistenten, hochkompetente Pflegefachpersonen, aber auch Bachelor- und Master-Absolventen, um komplexe Pflegeprozesse zu steuern und maßgebliche Handlungskompetenz einzubringen.
Damit der Pflegeberuf attraktiv bleibt, braucht es klare Karriereperspektiven. In Deutschland erschwert jedoch eine unglückliche Regelung die Situation: Der Bund regelt die Berufszulassung, die Länder bestimmen die Berufsausübung. Das führt zu uneinheitlichen Weiterbildungen in der Pflege und nicht abgestimmten Master-Studiengängen. Hier ist dringend eine Vereinheitlichung nötig. Dass Bund und Länder dazu fähig sind, zeigt der Gesetzentwurf zur Einführung einer bundeseinheitlichen Pflegefachassistenzausbildung, der derzeit im Bundestag diskutiert wird.
„Am Ende steht immer wieder die Frage, welchen Wert die Gesellschaft dem Pflegeberuf eigentlich zumisst.“
Mit der Anwerbung ausländischer Gesundheitsfachkräfte können nicht nur Lücken gefüllt, sondern auch neue, moderne Methoden in die Versorgung eingeführt werden. Wie wichtig ist das Ihrer Meinung nach?
Christine Vogler: Jede internationale Fachkraft, die in Deutschland arbeiten möchte, ist bei uns herzlich willkommen. Viele dieser Fachkräfte haben bereits Bachelor- oder Master-Abschlüsse in der Pflege. Dennoch werden sie bei uns auf ein Ausbildungsniveau abgestuft, nachdem sie einen Anpassungslehrgang absolviert haben. Diese Fachkräfte haben vielfach langjährige Berufserfahrungen und hohe Qualifikationen. Wir können von diesen Menschen auch lernen, wie im Gesundheitssystem gemeinsame Arbeit der Berufsgruppen auf Augenhöhe gewährleistet werden kann.
Ausländische Fachkräfte sind oft irritiert von den Handlungsfeldern, in denen sie in Deutschland arbeiten. In anderen Ländern wird den Gesundheitsberufen eine überragende Bedeutung zugemessen. In Deutschland gibt es nicht einmal eine Fortbildungs- und Registrierungspflicht in der Pflege. Wir wissen nicht, wie viele Kollegen wo arbeiten, was nicht nur in Krisenzeiten wichtig ist. Viele ausländische Kolleg:innen sind gerne in Deutschland und kommen in den Teams auch gut an, aber am Ende steht immer wieder die Frage, welchen Wert die Gesellschaft dem Pflegeberuf eigentlich zumisst.
Internationale Fachkräfte allein werden jedoch unseren Personalmangel in der Pflege nicht lösen. Über alle Branchen hinweg haben wir einen Generationenwechsel, bei dem anders mit Arbeit und Freizeit umgegangen wird. Diesen wesentlichen Punkt müssen wir in Einklang mit dem großen Anteil an ungünstigen Arbeitszeiten in der Pflege stellen, die immerhin zwei Drittel der Zeiten ausmachen. Das ist gerade in der Pflege ein wesentlicher Punkt, zu dem es Anreizsysteme und Antworten geben muss.
Mehr zum Thema lesen

Die Finanzierung der Kranken- und Pflegeversicherung bereitet zunehmend Sorgen. Mit reformierten Strukturen sollen die Mittel künftig effektiver eingesetzt werden.

Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hat den Abgeordneten ihre Reformpläne erläutert. Stärker einsetzen möchte sich die Ministerin für die Frauengesundheit.
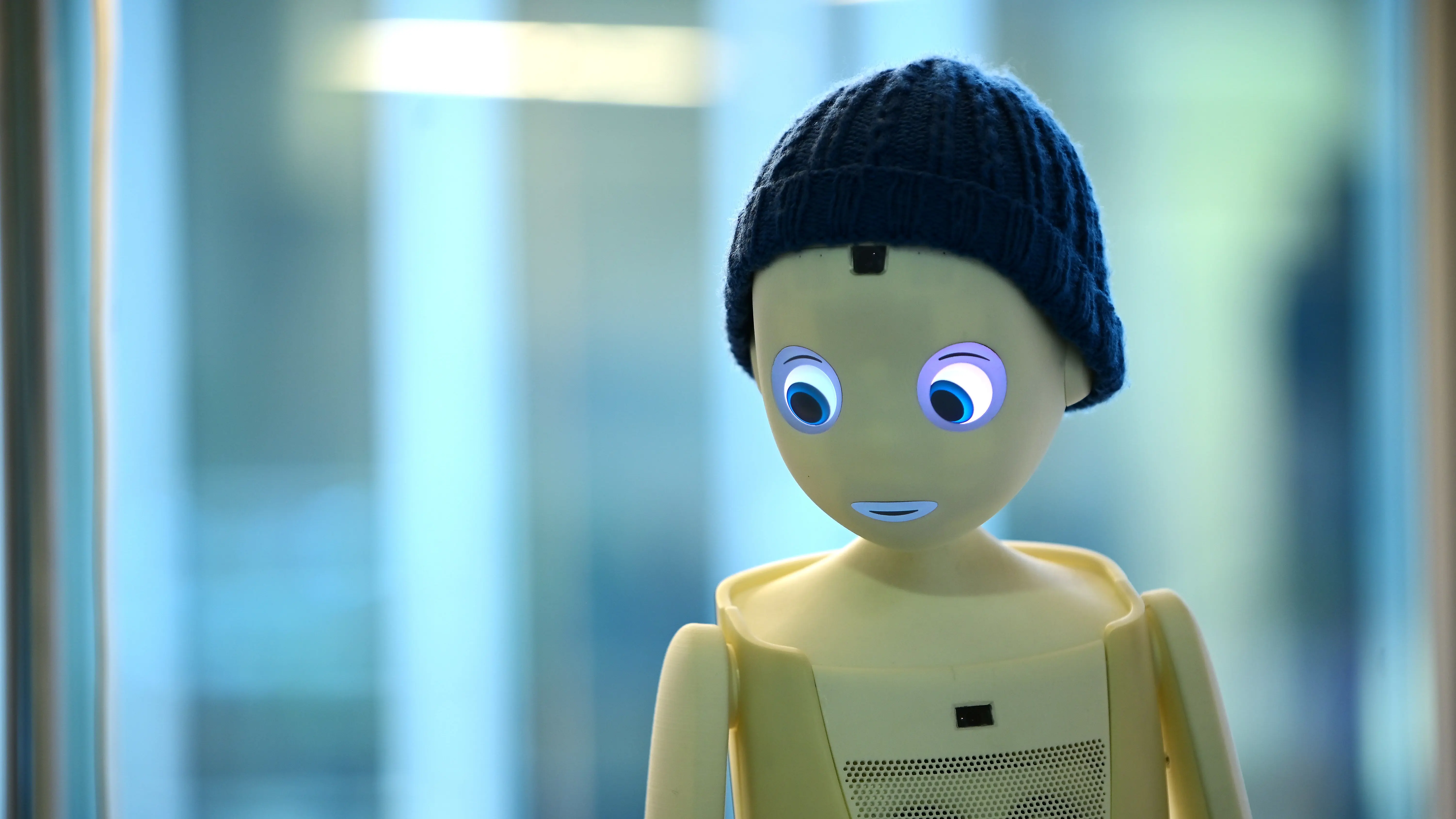
KI-Systeme können bereits jetzt präzise Diagnosen liefern und medizinisches Personal entlasten. Steht uns eine neue Ära der Gesundheitsversorgung bevor?
