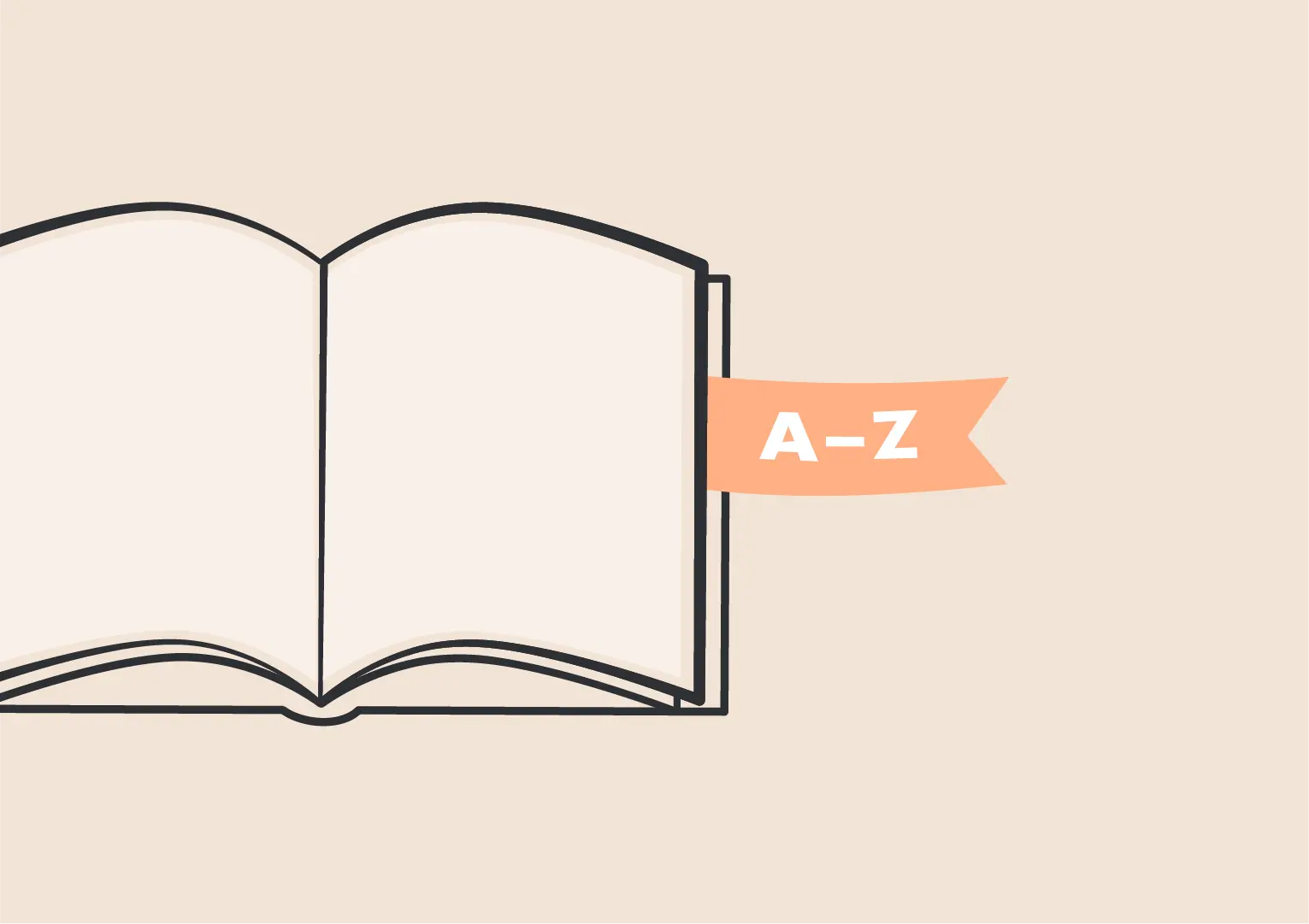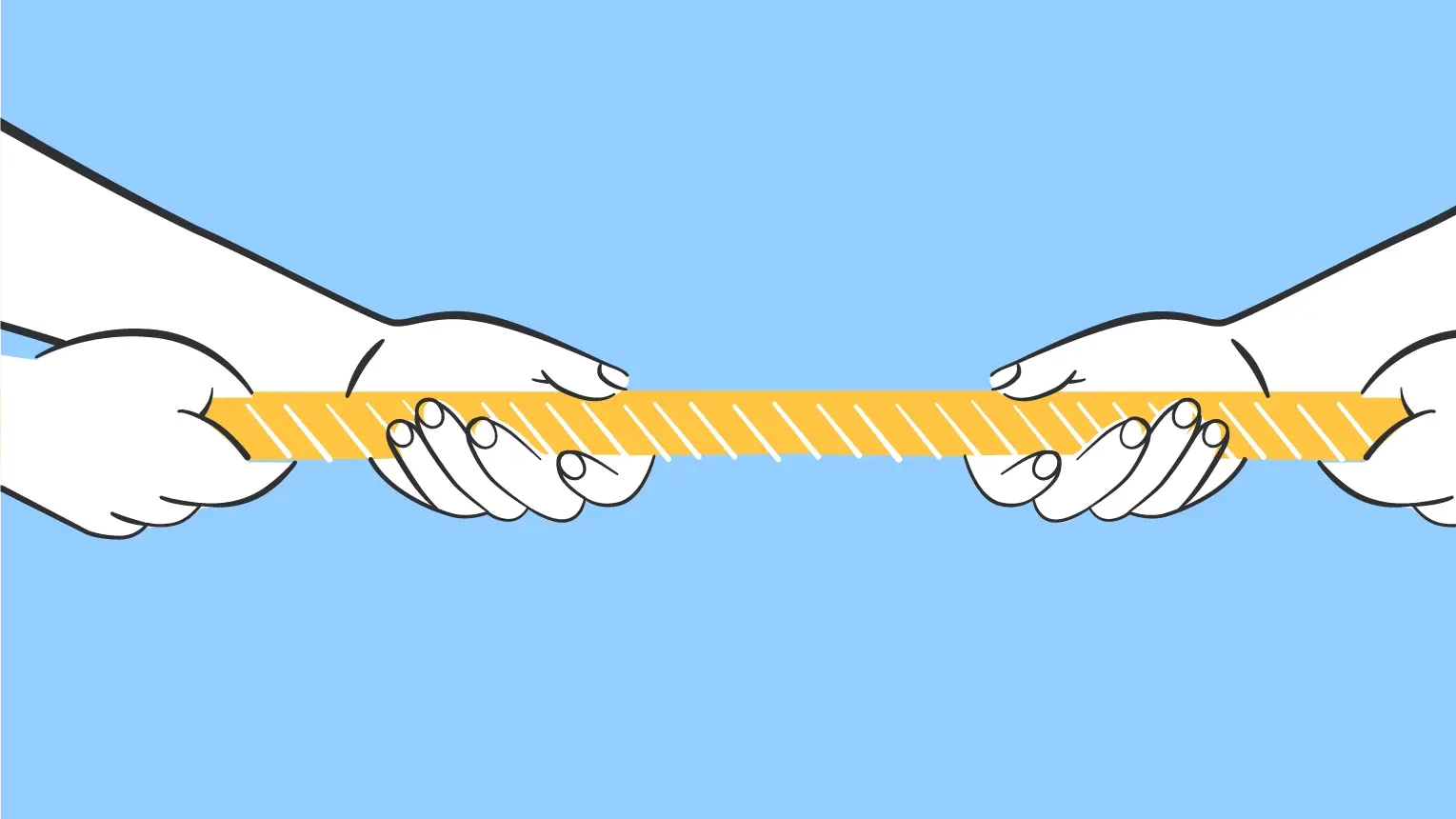Härteres Ausweisungsrecht, keine Turboeinbürgerung : Der schwarz-rote Kompromiss in der Migrationspolitik
Über die Asyl- und Migrationspolitik wird seit Jahren heftig gestritten. In ihrem Koalitionsvertrag setzen Union und SPD nun auf schärfere Regeln.
Im zurückliegenden Bundestagswahlkampf gehörte die Migrationspolitik zu den zentralen Streitthemen - man denke nur an den Ende Januar gescheiterten Versuch von Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU), zwei Tage nach der Annahme eines CDU/CSU-Entschließungsantrags für einen scharfen Kurswechsel in der Migrationspolitik mit den Stimmen der AfD im Bundestag auch einen Gesetzentwurf seiner Fraktion zur “Zustrombegrenzung” mit ähnlichen Mehrheitsverhältnissen durchzusetzen.
Es war eine Woche besonders harscher Töne im Parlament; die Gräben vor der Bundestagswahl am 23. Februar waren tief zwischen den Regierungsparteien und der größten Oppositionsfraktion. Indes, es war damals auch Merz, der in der hitzigen Debatte daran erinnerte, dass es nach dem 23. auch den 24. Februar geben werde und man dann "miteinander gesprächsfähig sein und bleiben" müsse.
Irreguläre Migration soll wirksam zurückgedrängt werden
Mittlerweile liegt die Bundestagswahl einige Wochen zurück, und Merz hat sich als voraussichtlich nächster Bundeskanzler mit der SPD auf die Bildung einer Koalition verständigt. "Verantwortung für Deutschland" lautet der Titel des schwarz-roten Koalitionsvertrages, der auf viereinhalb der knapp 150 Seiten die gefundene Kompromisslinie zwischen Union und Sozialdemokraten in der Migrationspolitik festhält.
Danach soll das Grundrecht auf Asyl unangetastet und die Bundesrepublik "ein einwanderungsfreundliches Land bleiben", dabei aber "einen anderen, konsequenteren Kurs in der Migrationspolitik" einschlagen. "Wir werden Migration ordnen und steuern und die irreguläre Migration wirksam zurückdrängen", schreiben die Koalitionäre in spe weiter und wollen dazu das Ziel der "Begrenzung" von Migration wieder ausdrücklich in das Aufenthaltsgesetz aufnehmen - was übrigens auch im erwähnten Zustrombegrenzungsgesetz der Union vom Januar vorgesehen war.

Polizisten der Grenzpolizei sind anderem für die Grenzüberwachung, Grenzkontrolle und die Abwehr von Gefahren, die die Sicherheit der Grenzen beeinträchtigen, zuständig.
Unter Beibehaltung der von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) seit September 2024 auf alle deutschen Landgrenzen ausgedehnten Grenzkontrollen sollen dort dem Vertrag zufolge künftig auch Menschen zurückgewiesen werden, die ein Asylgesuch stellen - allerdings nur "in Abstimmung" mit den Nachbarstaaten. Die Zahl asylrechtlich sicherer Herkunftsstaaten wollen Union und SPD erweitern und dabei mit der entsprechenden Einstufung Indiens sowie der Maghreb-Staaten Algerien, Marokko und Tunesien beginnen. Folgen sollen insbesondere solche Länder, "deren Anerkennungsquote seit mindestens fünf Jahren unter fünf Prozent liegt".
Einstufung sicherer Herkunftsstaaten soll erleichtert werden
Bei als sicher eingestuften Staaten wird gesetzlich davon ausgegangen, dass dort generell keine staatliche Verfolgung zu befürchten ist, wodurch Asylverfahren ihrer Angehörigen schneller bearbeitet werden können. Im Fall der drei Maghreb-Staaten hatten schwarz-rote Koalitionen schon 2016 und 2019 entsprechende Gesetzesbeschlüsse des Bundestages erreicht, die jedoch - insbesondere durch den Widerstand der Grünen - im Bundesrat nicht die erforderliche Zustimmung fanden.
Laut Grundgesetz-Artikel 16a können sichere Herkunftsstaaten durch ein Gesetz bestimmt werden, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf. In ihrem Koalitionsvertrag sehen Union und SPD nun vor, die Einstufung sicherer Herkunftsstaaten durch Rechtsverordnung der Bundesregierung zu ermöglichen.
Als Maßnahmen zur Begrenzung legaler Zugangswege nach Deutschland werden in dem Papier ferner die Beendigung freiwilliger Bundesaufnahmeprogramme wie etwa für Afghanistan sowie eine auf zwei Jahre befristete Aussetzung des Familiennachzugs für subsidiär Schutzberechtigte genannt. Um legale Zuwanderung zu steuern und die Rücknahmebereitschaft sicherzustellen, wird zugleich ein verstärkter Abschluss sogenannter Migrationsabkommen mit den relevanten Herkunftsstaaten angestrebt.
Bei der regulären Migration im Rahmen der sogenannten Westbalkan-Regelung, die für jede Beschäftigung einen Zugang zum Arbeitsmarkt in Deutschland eröffnet, ist die Festlegung einer jährlichen Obergrenze von 25.000 Personen vorgesehen.
Laut Koalitionsvertrag ist eine Verschärfung des Ausweisungsrechts geplant
Die zu "Ampel"-Zeiten beschlossene Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems soll dem Koalitionsvertrag zufolge noch in diesem Jahr in nationales Recht umgesetzt werden. Vorgesehen ist auch, das Ausweisungsrecht zu verschärfen: Künftig soll bei schweren Straftaten die Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe zu einer Regelausweisung führen.
Zugleich will Schwarz-Rot eine "Rückführungsoffensive starten" (was auch im Koalitionsvertrag der Ampel von 2021 angekündigt war) und "Herkunftsländer in die Pflicht nehmen". Ziel ist, "mit allen Politikfeldern eine bessere Kooperationsbereitschaft der Herkunftsländer zu erreichen, einschließlich der Visa-Vergabe, Entwicklungszusammenarbeit, Wirtschafts- und Handelsbeziehungen". Daneben sollen "umfassende gesetzliche Regelungen" die Zahl der Rückführungen steigern.
Der verpflichtend beigestellte Rechtsbeistand vor der Durchsetzung einer Abschiebung soll nach dem Willen von Union und Sozialdemokraten wieder abgeschafft werden. Die Ampel-Koalition hatte im Januar 2024 mit dem "Rückführungsverbesserungsgesetz" eingeführt, dass Betroffenen in Verfahren zur Abschiebungshaft oder Ausreisegewahrsam ein Pflichtverteidiger zur Seite gestellt werden muss.
Die Bundespolizei kann laut dem jetzt vorgelegten Koalitionsvertrag in Zukunft für ausreisepflichtige Ausländer vorübergehende Haft oder Ausreisegewahrsam beantragen, um ihre Abschiebung sicherzustellen. Ermöglicht werden soll zudem ein "dauerhafter Ausreisearrest für ausreisepflichtige Gefährder und Täter schwerer Straftaten nach Haftverbüßung", bis die freiwillige Ausreise oder Abschiebung erfolgt. Abschiebungen soll es unter einer schwarz-roten Koalition auch nach Afghanistan und Syrien geben - "beginnend mit Straftätern und Gefährdern".
Mehr zum Koalitionsvertrag

Im Koalitionsvertrag setzen Union und SPD auf Steueranreize für mehr Investitionen und weniger Bürokratie, um die Wirtschaft wieder auf Wachstumskurs zu bringen.

Union und SPD wollen die „Zeitenwende“ weiter ausbuchstabieren: Im Zentrum des Koalitionsvertrags steht die Stärkung der Verteidigungs- und Abschreckungsfähigkeit.

Neuer Name für das Bürgergeld und stabiles Rentenniveau bis 2031– das haben sich Union und SPD laut Koalitionsvertrag in der Arbeits- und Sozialpolitik vorgenommen.
“Turboeinbürgerung” steht auf der Streichliste von Union und SPD
Bei den Leistungen für Ausreisepflichtige setzt der Vertrag auf eine "konsequente Umsetzung der bestehenden Anspruchseinschränkungen im Leistungsrecht". Bedürftige Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, die bislang Anspruch auf Bürgergeld hatten, sollen künftig die geringeren Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten, sofern sie nach dem 1. April dieses Jahres eingereist sind.
Wieder abschaffen wollen Union und SPD auch die von der Ampel-Koalition im Januar 2024 bei der Reform des Staatsangehörigkeitsrechts eröffnete Möglichkeit der "Turboeinbürgerung" nach drei Jahren bei "besonderen Integrationsleistungen". Darüber hinaus bleibt es auch unter Schwarz-Rot bei der Reform des Staatsbürgerschaftsrecht, zu der neben einer generellen Hinnahme von Mehrstaatigkeit auch gehörte, dass eine Einbürgerung in der Regel bereits nach einem Aufenthalt von fünf statt vorher acht Jahren möglich ist.
Insgesamt lässt sich bei dem Migrationskompromiss von Union und SPD feststellen, dass beide Seiten Punkte setzen konnten. Welche Wirksamkeit die einzelnen Maßnahmen tatsächlich entfalten, muss sich indes erst noch erweisen.
Immerhin starten die möglichen Koalitionspartner in einer Phase rückläufiger Asylbewerberzahlen: So haben laut dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) von Januar bis März dieses Jahres 41.123 Menschen in Deutschland einen Asylantrag gestellt, 36.136 Erst- und 4.987 Folgeanträge - eine Abnahme um 44,8 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum.