Deutschland im Nationalsozialismus : Missstimmung in der Volksgemeinschaft
Der Historiker Peter Longerich hat die Stimmung der Deutschen im "Dritten Reich" neu ausgelotet und kommt zu einem differenzierten Befund.
Waren die Deutschen "unwillige Volksgenossen"? Waren sie mit der nationalsozialistischen Ideologie und Politik wirklich unzufrieden? Wenn ja, dann befand sich die Forschung lange Zeit auf einer falschen Fährte. Die Mehrzahl der Historiker war sich einig, dass das deutsche Volk mit zunehmendem politischem, sozialem und militärischem Erfolg hinter Adolf Hitler stand.
Der renommierte NS-Experte Peter Longerich widerspricht anhand von zeitgenössischen Stimmungsberichten aus verschiedenen Quellen dieser Sicht. Obgleich die überlieferten Dokumente über die zwölf Jahre NS-Herrschaft inhaltlich sehr disparat sind, keine Kontinuität aufweisen und verschiedenste Urheber haben, ergibt sich doch ein differenziertes und überraschendes Bild der Stimmungslage innerhalb der deutschen Bevölkerung.

Das Bild der NS-Propaganda: Passanten zeigen im März 1938 während eines Aufmarsches der SA in Berlin den sogenannten „Deutschen Gruß".
Longerich entwirft auf Basis der Berichte der Gestapo, Landräte, Justiz, Wirtschaftsbehörden und des Sicherheitsdienstes, der NS-Verbände sowie der Deutschland-Berichte der Sozialdemokratischen Partei im Exil ein sehr facettenreiches Bild. Mit der nötigen quellenkritischen Vorsicht interpretiert er das riesige Konvolut an Akten. Hinter den vorsichtigen Formulierungen und Andeutungen in den Quellen lässt sich jedoch die Unzufriedenheit vieler Bevölkerungsteile herauslesen. Longerich konzentriert sich dabei auf die Lage der Arbeiterschaft, der Landwirtschaft und Bauern, des Mittelstandes, der Kirchen und der lokalen Parteiorganisationen.
Mehrheitliche Ablehnung des NS-Regimes in der Arbeiterschaft
Hinlänglich ist bekannt, dass Hitler nie mit der absoluten Mehrheit vom deutschen Volk gewählt worden ist. Gewalt, Repressionen und Verbote haben die Machtübernahme und -festigung schließlich ermöglicht. Die seit Januar 1933 propagierte Aufbruchsstimmung teilten keineswegs alle Deutschen und auch an den Massenveranstaltungen nahm längst nicht jeder Anteil.
Vielfach passten sich bürgerliche und konservative Kreise nach außen hin an, blieben aber ihren Werten treu. Nicht neu ist, dass die Mehrheit der Arbeiterschaft dem Regime gegenüber eher ablehnend gegenüberstand. Unzufriedenheit machte sich aber auch in der Landwirtschaft und im Handwerk und Handel breit, weil sich die ökonomischen Versprechungen für sie nicht oder kaum erfüllten. Longerich beobachtet in all diesen Gesellschaftsbereichen über die gesamte NS-Herrschaft hinweg eine latente Missstimmung, die sich in kleineren Protesten und widerständigem Verhalten manifestierte.
Die evangelische und katholische Kirche behauptete vor allem in kleineren Kreisen ihren Glauben und bildeten eine Gegengemeinschaft zur "Volksgemeinschaft". Der nicht parteigebundenen Bevölkerung stieß die Vetternwirtschaft der Parteifunktionäre bitter auf, was sich in den Stimmungsberichten deutlich widerspiegelt. Insbesondere das gewalttätige Verhalten der SA und der mitunter rüpelhaften Hitlerjugend war immer wieder Grund zur Verärgerung in der Bevölkerung. Selbst innerhalb der Parteiorganisationen brodelte es, wenn der ein oder andere ungerechterweise begünstigt wurde.
Skepsis gegenüber dem Militarismus und die Angst vor einem Krieg
Von der "Volksgemeinschaft" war nach Longerich schon bald nurmehr propagandistisch die Rede, in Wirklichkeit sei die Gesellschaft jedoch tief gespalten gewesen. Auch die außenpolitischen "Erfolge" sowie die Einführung der Wehrpflicht seien zunehmend mit Skepsis betrachtet worden. Viele sahen im Expansionismus und der Militarisierung die Vorboten des Krieges, der 1939 diese Ängste bestätigte.
Trotz der anfänglichen Siege löste er keine dauerhafte Begeisterung aus, geschweige denn nach 1941. Auch die antisemitische Gesetzgebung und Gewalt wurde meist von der der Partei nahestehenden Bevölkerung mit entsprechendem Rückhalt unterstützt und angefeuert. Gleichwohl wussten viele Deutsche von Deportationen, Repressionen und Gewalt gegen Juden, ohne dagegen vorzugehen.
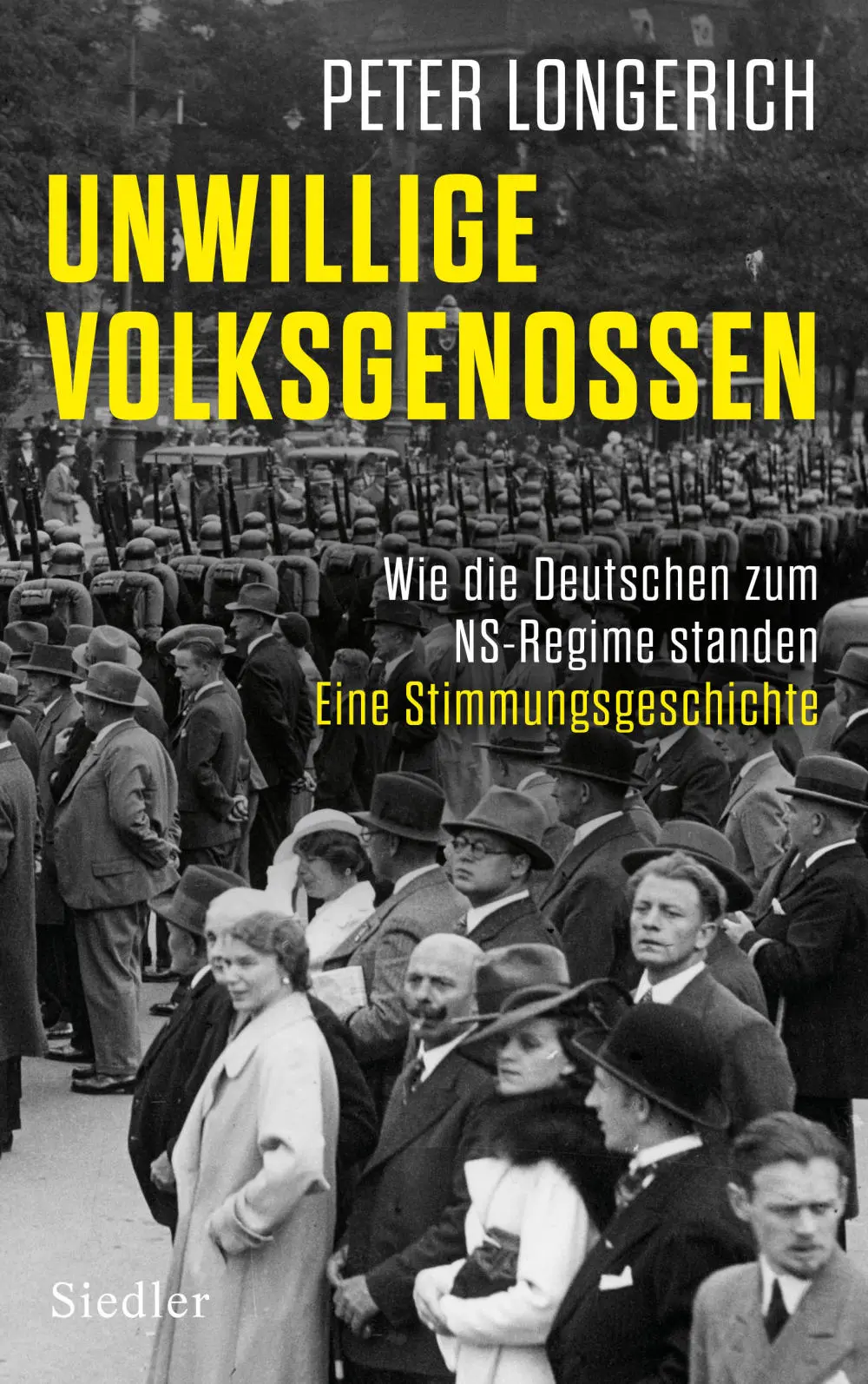
Peter Longerich:
Unwillige Volksgenossen.
Wie die Deutschen zum NS-Regime standen. Eine Stimmungsgeschichte.
Siedler,
München 2025;
640 S., 34,00 €
Bei all diesen Beobachtungen erstaunt es immer wieder, dass es zwar vereinzelt Proteste und widerständige Aktionen gab, aber die innere Opposition oder sogar Gleichgültigkeit vorherrschte. Die in den Stimmungsberichten aufscheinende breite Unzufriedenheit in vielen Bevölkerungsschichten führte nicht zu allgemeinem Aufruhr oder Widerstand auf breiter Basis, die das Regime hätte stürzen können.
Passivität und fehlende Zivilcourage begünstigen Diktaturen
Es bleibt also nach Longerichs Stimmungsbarometer die Frage offen, auf welchem Fundament das nationalsozialistische Regime seine Herrschaft konsolidieren konnte und inwiefern sich Diktaturen ohne größere Zustimmung behaupten können. Nicht allein die Angst vor Gewalt, Repression und Bestrafung begünstigen Diktaturen.
Politische Passivität, mangelndes Interesse und fehlende Zivilcourage sind die Einfallstore und Anker totalitärer Herrschaftssysteme. Insofern trägt Longerichs Buch dazu bei, die aktuellen politischen Entwicklungen achtsam zu betrachten und gegebenenfalls couragiert zu handeln.
Mehr zum Nationalsozialismus

Am Beispiel Adolf Hitlers hinterfragt Lutz Hachmeister den Sinn von Interviews mit Diktatoren und warnt vor der Gefahr ihrer Instrumentalisierung.

Jens Bisky hat mit „Die Entscheidung“ ein großartiges Buch über die letzten Jahre der ersten deutschen Demokratie vorgelegt.

Die Sozialdemokraten lehnten das Ermächtigungsgesetz der Nazis ab. Eine Mehrheit fand sich trotzdem in der dunkelsten Stunde deutscher Parlamentsgeschichte.
