Vor 80 Jahren : NS-Verbrecher auf der Anklagebank
Im November 1945 begannen die Nürnberger Prozesse - sie gelten als Geburtsstunde des Völkerstrafrechts. Angeklagt waren 24 Hauptkriegsverbrecher.
"Die Untaten, die wir zu beurteilen und zu bestrafen suchen, waren so ausgeklügelt, so böse und von so verwüstender Wirkung, dass die menschliche Zivilisation es nicht dulden kann, sie unbeachtet zu lassen, sie würde sonst eine Wiederholung solchen Unheils nicht überleben." Mit diesen Worten machte der US-amerikanische Chef-Ankläger Robert Jackson die Tragweite der Nürnberger Prozesse gleich in seiner Eröffnungsrede deutlich: Erstmals ging es vor einem Gericht um Verbrechen gegen den Weltfrieden. Das 1945 von den Siegermächten des Zweiten Weltkriegs unterzeichnete "Statut für den Internationalen Militärgerichtshof" gilt als Geburtsurkunde des Völkerstrafrechts.

Der Chefankläger des Tribunals, der US-Amerikaner und ehemalige Bundesrichter Robert H. Jackson, nannte die Angeklagten in seiner Eröffnungsrede "lebende Sinnbilder des Rassenhasses, der Herrschaft des Schreckens und der Gewalttätigkeit".
Am 20. November 1945 begann der Prozess gegen 24 Hauptkriegsverbrecher, die sich nicht - wie Diktator Adolf Hitler, Propagandaminister Joseph Goebbels oder SS-Chef Heinrich Himmler - schon bei Kriegsende das Leben genommen hatten. Die Vorwürfe: Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Vorbereitung und Durchführung eines Angriffskriegs.
Da Robert Ley, Leiter der Deutschen Arbeitsfront, vor Prozessbeginn Selbstmord beging, Gustav Krupp von Bohlen und Halbach wegen Schlaganfällen als nicht verhandlungsfähig galt und gegen den Hitler-Vertrauten Martin Bormann in Abwesenheit verhandelt wurde, saßen letztlich aber nur 21 Männer auf der Anklagebank. Darunter Luftwaffenchef Hermann Göring, NS-Außenminister Joachim von Ribbentrop, Hitler-Stellvertreter Rudolf Heß oder Rüstungsminister Albert Speer.
Ein Prozess von nie dagewesener Dimension
Ursprünglich sollte der Prozess in Berlin stattfinden, doch in der Reichshauptstadt fehlte es an Örtlichkeiten. Dass die Wahl dann auf Nürnberg fiel, lag einerseits am dortigen Justizpalast in der Fürther Straße mit angeschlossener Haftanstalt, andererseits hatte die Stadt für die NS-Zeit auch symbolischen Charakter: Dort wurden 1935 die nach der Stadt benannten Rassengesetze verabschiedet, dort hielt die NSDAP immer wieder ihre pompösen Reichsparteitage ab. So wurden die NS-Verbrecher auf ihrer einstigen Bühne verurteilt.
Der Prozess war von nie dagewesener Dimension. 1.000 Mitarbeiter begleiteten die Verhandlung, darunter Vernehmungspersonal, Dolmetscher und Schreibkräfte. An 218 Tagen wurde in Saal 600 des Gerichtsgebäudes verhandelt, dabei wurden rund 360 Zeugenaussagen, 200.000 eidesstattliche Versicherungen und 5.330 Dokumente, darunter auch Filmaufnahmen, eingeführt.
Am 1. Oktober 1946 wurden die Urteile gesprochen. Der Vorsitzende, der britische Lordrichter Geoffrey Lawrence, verkündete zwölf Todesstrafen, gegen sieben Angeklagte wurden Freiheitsstrafen zwischen zehn Jahren und lebenslänglich verhängt. Drei Angeklagte, etwa der frühere Reichskanzler Franz von Papen, der als Schlüsselfigur auf Hitlers Weg zur Machtergreifung gilt, wurden freigesprochen. Bis 1949 wurden gegen weitere Kriegsverbrecher zwölf weitere Prozesse geführt. "Dass vier große Nationen, berauscht vom Sieg (...) die Hand der Rache zurückhalten und ihre gefangenen Feinde freiwillig dem Urteil des Gesetzes unterwerfen", nannte Ankläger Robert Jackson, “eine der bedeutendsten Ehrungen, die die Macht jeder Vernunft erwiesen hat.”
Mehr Bücher zum Nationalsozialismus

Der Historiker Peter Longerich hat die Stimmung der Deutschen im "Dritten Reich" neu ausgelotet und kommt zu einem differenzierten Befund.

Der Historiker und Schriftsteller Oliver Hilmes spürt in seinem Buch "Ein Ende und ein Anfang" dem Lebensgefühl im Sommer 1945 nach.
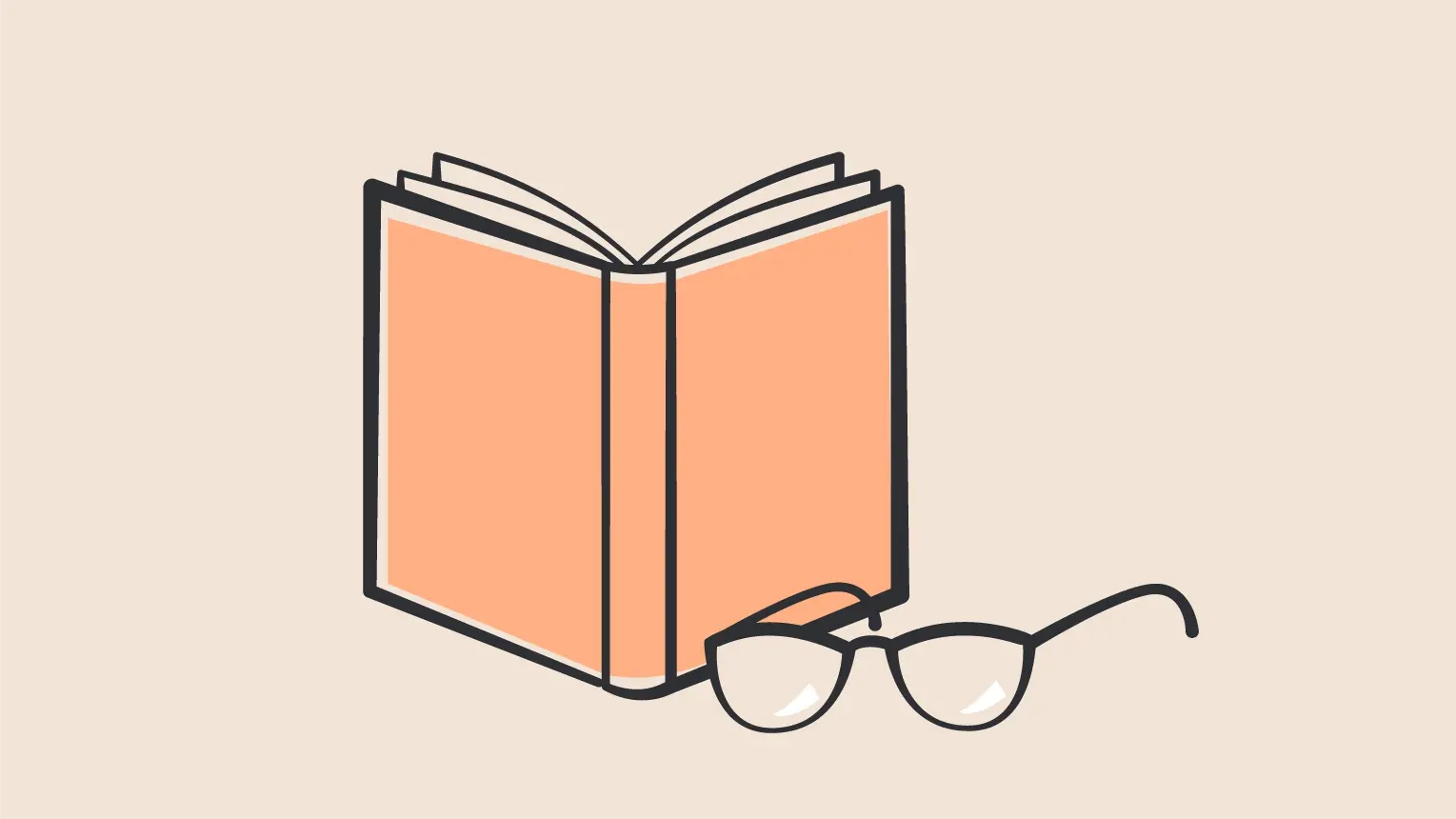
Ein außergewöhnliches Schulprojekt wird zur politischen Stimme: 27 Jugendliche aus Brandenburg schreiben Texte für Demokratie und gegen Extremismus.
