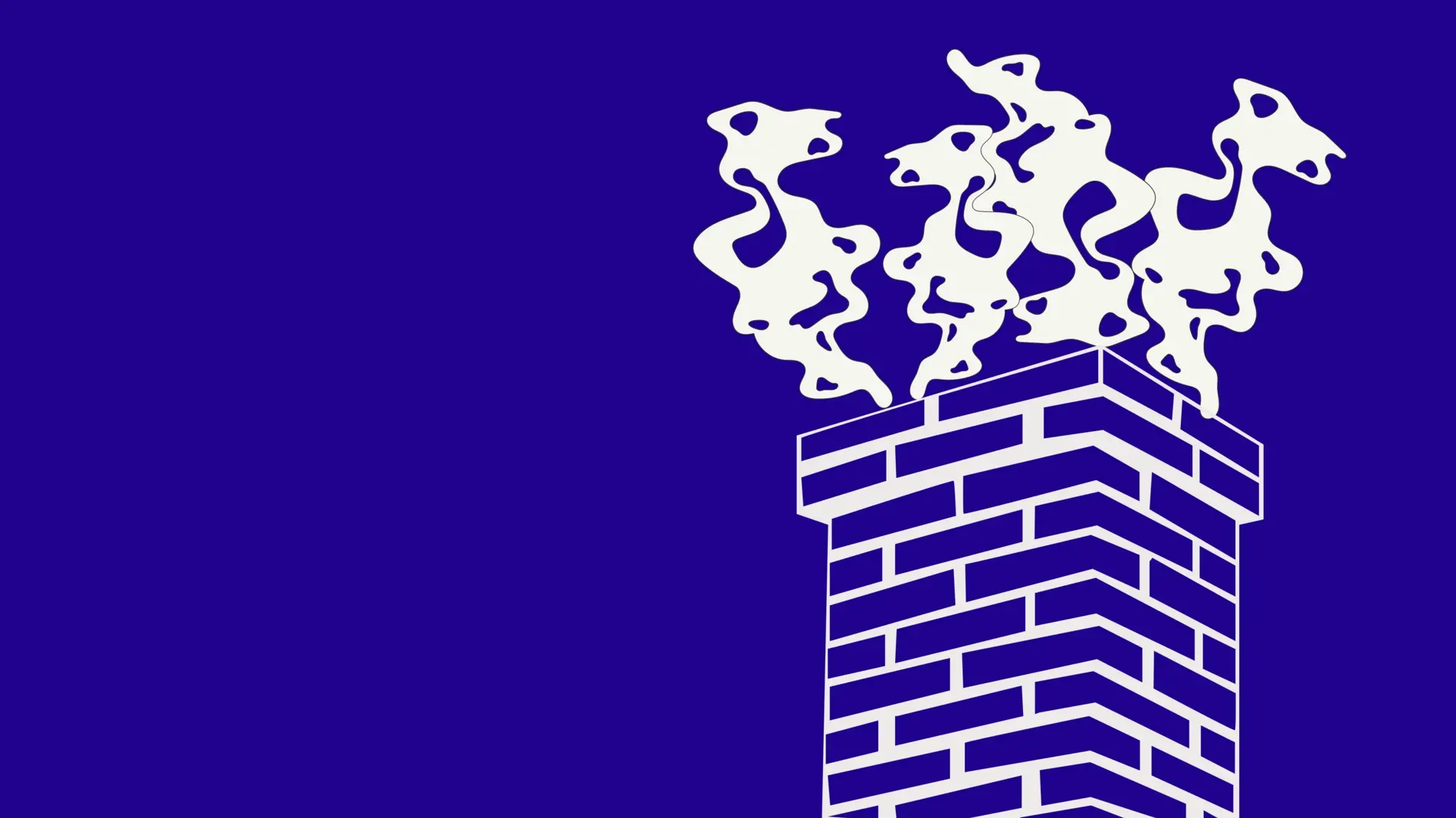EU-Klimaziele : EU will 90 Prozent weniger Emissionen bis 2040
Die EU bleibt bei ihrem CO2-Reduktionsziel. Gleichzeitig will sie den Mitgliedstaaten beim Erreichen mehr „Flexibilität“ ermöglichen. Doch was bedeutet das genau?
Die Europäische Union bleibt bei ihrem Kurs gegen globale Erderwärmung und setzt sich ein neues Klimaziel für 2040. Um 90 Prozent soll der Treibhausgasausstoß der EU-Mitgliedstaaten bis in 15 Jahren im Vergleich zu 1990 sinken. 2024 hatte die EU-Kommission bereits dieses Ziel als eine rechtlich unverbindliche Empfehlung abgegeben.
Am Mittwoch nun legte sie in Brüssel einen entsprechenden Gesetzentwurf vor vor und setzt damit ein weiteres verbindliches Zwischenziel auf dem Pfad zur Klimaneutralität: Bis 2050 will die EU klimaneutral sein, also nicht mehr Treibhausgase wie Kohlendioxid und Methan ausstoßen, als wieder gebunden werden können. Bis 2030 sollen 55 Prozent der Emissionen eingespart werden.
Widerstand von EU-Ländern gegen zu ambitionierte Klimaziele
Ein Ziel, bei dem die EU-Länder weitgehend auf Kurs sind. Der Expertenrat für Klimafragen bescheinigte der Bundesregierung in einem im Februar veröffentlichten Gutachten, dass das Klimaziel 2030 „in Reichweite“ sei. Deutschland hat sich vorgenommen, bis dahin die Emissionen um 65 Prozent zu reduzieren. Gleichzeitig mahnten die Experten mehr Anstrengungen an, um weitergehende Klimaziele zu erreichen. In immer mehr EU-Ländern regte sich zuletzt aber Widerstand; die europäischen Klimaziele wurden von vielen als zu ambitioniert empfunden. Frankreich, Polen und Italien hätten lieber ein 2040-Klimaziel verschoben – oder ganz verzichtet.
In einem zentralen Punkt kommt die EU-Kommission ihnen entgegen und weicht dabei auch von wissenschaftlichen Empfehlungen ab: Während bislang Treibhausgase vollständig innerhalb der EU eingespart werden müssen, kann dem Gesetzentwurf zufolge ein Teil der Emissionsminderung künftig in Drittstaaten erfolgen. Ab 2036 dürften die EU-Länder für bis zu drei Prozent der angestrebten CO2-Einsparungen Klima-Zertifikate kaufen. Sie dürfen damit mehr Kohlendioxid ausstoßen als erlaubt, wenn sie Klimaschutzmaßnahmen wie etwa die Aufforstung von Regenwald in Afrika finanzieren.
„Die EU steht zu ihrer Verpflichtung, die Industrie bis 2050 zu dekarbonisieren.“
„Die EU steht zu ihrer Verpflichtung, die Industrie bis 2050 zu dekarbonisieren“, teilte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) zu dem Gesetzentwurf mit. Die Fortsetzung der Klimapolitik schaffe Planungssicherheit und sichere Investitionen in die grüne Transformation Europas, sagte Klima-Kommissar Wopke Hoekstra am Mittwoch. Zugleich verteidigte er die jetzt im Gesetzentwurf vorgesehene „Flexibilität“. Es sei nicht entscheidend, wo Emissionen auf der Welt reduziert würden. Daher halte die Kommission es für „fair“, Unternehmen und Ländern mehr Spielraum zu geben.
Kritiker sprechen von einer Verwässerung des Klimaziels
Damit solche Klimaschutzmaßnahmen in der EU anerkannt werden, sollen die Zertifikate strengen Kriterien entsprechen. Grundlage dafür ist Artikel 6 des Pariser Klimaabkommens, der unter anderem den internationalen Handel mit Klimazertifikaten regelt. Allerdings ist die Anrechnung von Klima-Zertifikaten umstritten, da es in der Vergangenheit zu Betrugsfällen kam.
Kritiker wie der Europaparlaments-Abgeordnete Michael Bloss (Grüne) werfen der EU-Kommission jedoch vor, das Klimaziel zu verwässern. „Rechentricks und Etikettenschwindel dürfen den Klimaschutz nicht untergraben“, fordert er. Die Möglichkeit zur Anrechnung von CO2-Zertifikaten in Höhe von drei Prozent sei ein Risiko, so Bloss. „Drei Prozent entsprechen 145 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten jedes Jahr - so viele Emissionen wie Schweden, Finnland und Dänemark im Jahr 2023 ausgestoßen haben.“
Abgeordnete kritisieren Anrechnung von Klima-Zertifikaten
Auch Tiemo Wölken, Sprecher der Sozialdemokraten im Umweltausschuss des Europaparlaments, kritisiert die Einbeziehung von internationale Klimagutschriften. „In Zukunft werden damit Finanzmittel, die für Investitionen in die Transformation der europäischen Wirtschaft und Gesellschaft gebraucht werden, außerhalb der EU investiert“. Ob solche Klimaschutzprojekte die Emissionen tatsächlich dauerhaft verringerten oder ausglichen, sei zweifelhaft. Wie schwierig sie umzusetzen und zu überwachen seien, zeige beispielsweise der Betrug mit falsch deklariertem, angeblich nachhaltigem Biosprit aus fiktiven Anlagen in China.

„Wer die Flexibilität ablehnt, riskiert, dass es am Ende gar kein Ziel für 2040 gibt.“
Peter Liese (CDU), Sprecher für Klimafragen der EVP-Fraktion im Europaparlament, spricht hingegen von einer pragmatischen Lösung. „Wer die Flexibilität ablehnt, riskiert, dass es am Ende gar kein Ziel für 2040 gibt“, warnt er. Weder im Parlament noch im Rat gebe es eine sonst eine Mehrheit für ein 2040-Ziel. An der Notwendigkeit des Klimaschutzes bestehe zwar kein Zweifel, gerade erlebe Europa erneut eine Hitzewelle, sagt Liese. Dennoch fürchteten viele, mit zu strengen Vorgaben die Unternehmen zu überfordern. Der Entwurf der EU-Kommission stelle nun die Machbarkeit in den Mittelpunkt.
Bundesregierung begrüßt Vorschlag der EU-Kommission
Eine Einbeziehung von Klima-Zertifikaten zur Erreichung des 2040-Klimaziels hatte die schwarz-rote Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag gefordert. Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) unterstützt so nun auch den Entwurf der EU-Kommission: Dieser sei ein „wichtiges Signal an die Welt“ und ein „Beleg, dass Europa Zugpferd beim internationalen Klimaschutz“ bleibe. Der Vorschlag müsse nun schnell beraten und beschlossen werde, drängt der Minister.
Tatsächlich müssen die EU-Länder jetzt mit dem Europaparlament zügig verhandeln. Das verbindliche Klimaziel für 2040, das es laut EU-Klimagesetz geben muss, soll als Grundlage für die Klimapläne genutzt werden, welche die EU bei den Vereinten Nationen einreichen muss. Bis spätestens September müssen die Klimaschutzpläne für den Zeitraum bis 2035 vorliegen, damit sie noch rechtzeitig vor der nächsten Weltklimakonferenz kommen - die COP30 findet vom 10. bis 21. November im brasilianischen Belém statt.
Mehr zum Thema lesen

Kommissionspräsidentin von der Leyen will CO2-Vorgaben für Autobauer lockern und die Nachfrage nach E-Autos steigern. Das Verbrenner-Aus soll überprüft werden.
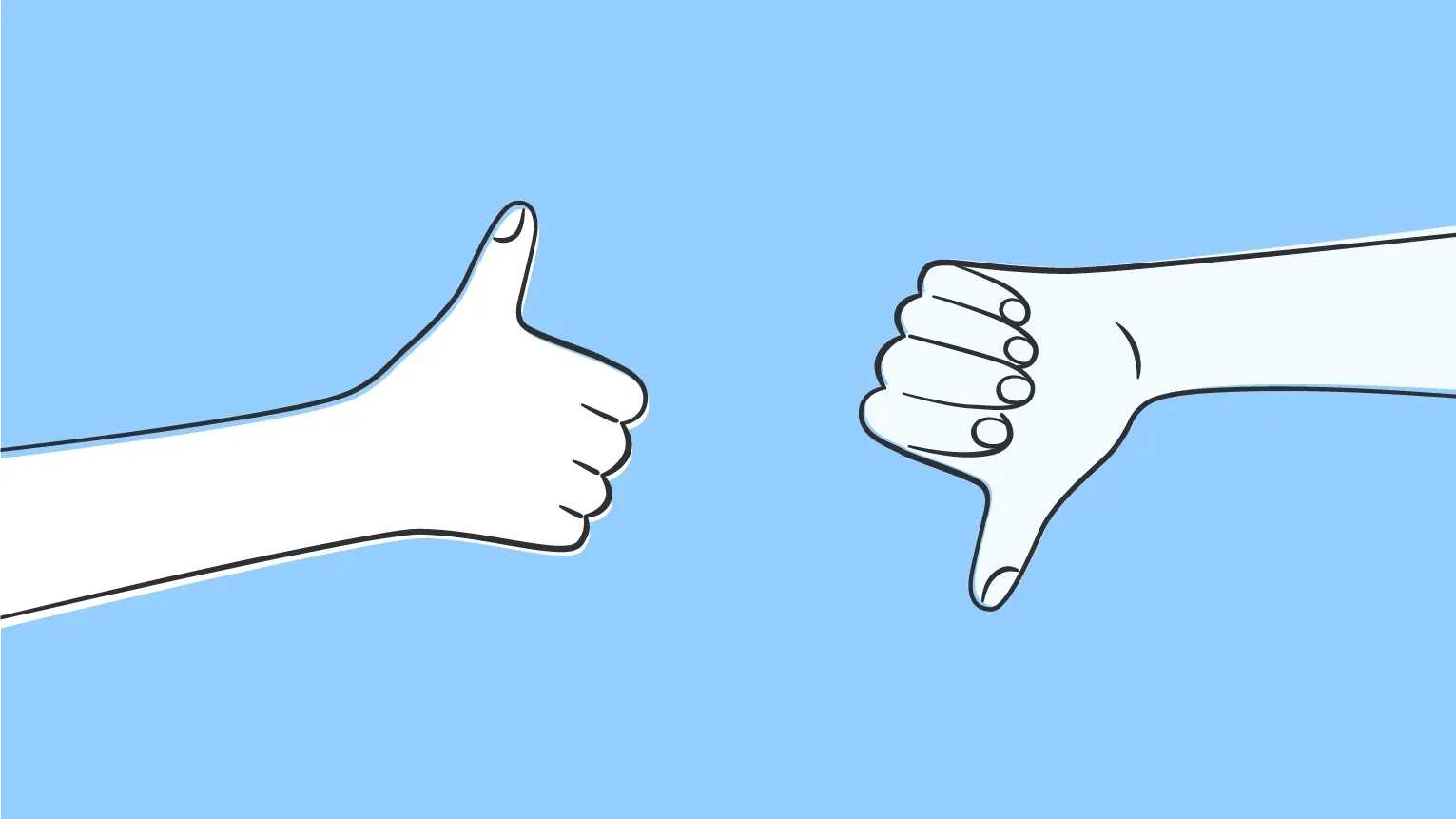
Muss Ursula von der Leyens "Green Deal" der EU nach der Europawahl neu verhandelt werden? Markus Fasse und Anja Wehler-Schöck im Pro und Contra.

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen stellt ihr Arbeitsprogramm für mehr Wettbewerbsfähigkeit und weniger Bürokratie vor. Das sieht Brüssels neue Agenda vor.