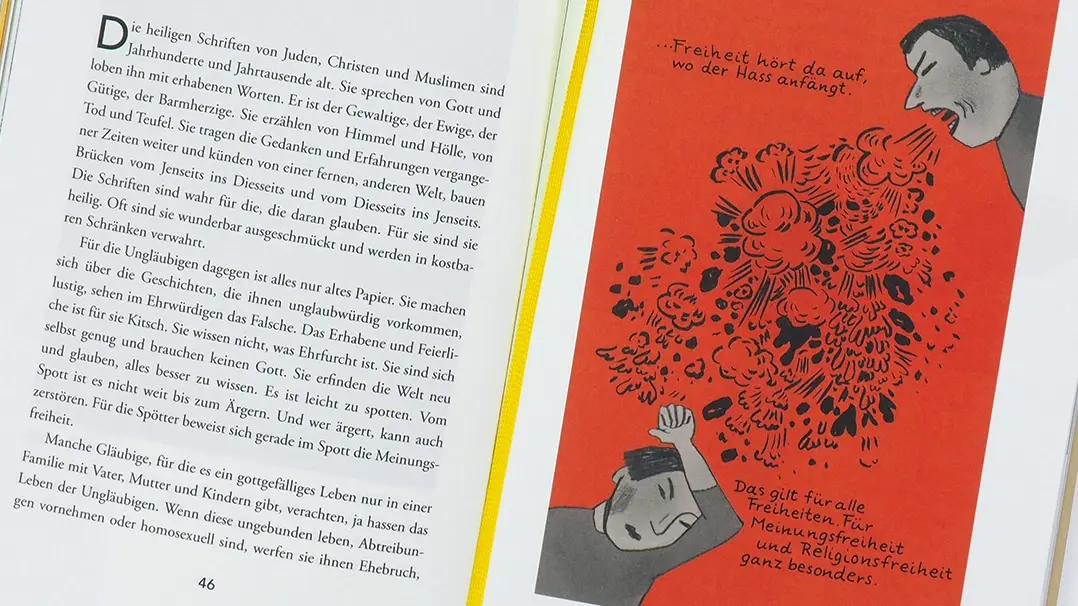75 Jahre Europäische Menschenrechts-Konvention : "Dieser Vertrag ist das Gewissen Europas"
Kriege, autoritäre Regime, wachsender Populismus: Die Völkerrechtlerin Angelika Nußberger warnt vor einer Schwächung des Menschenrechtssystems in Europa.
Frau Nußberger, im November 1950 wurde die Europäische Menschenrechtskonvention unterzeichnet. Was bedeutet sie für Europa?
Angelika Nußberger: Man muss den Vertrag zeitgeschichtlich einordnen. 1950 hatte der Kalte Krieg begonnen und Europa suchte nach Zusammenhalt - und nach einem Markenzeichen. Die Zeit war günstig, um die Konvention in Anlehnung an die Vorgaben der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 auszuarbeiten. Mit der Menschenrechtskonvention wollte man in Europa ein wirksames Instrument zur Absicherung politischer Rechte schaffen. Es ging darum, die Rechte des Einzelnen in den Mittelpunkt zu stellen und damit die Souveränität der Staaten einzuschränken. In der Entwicklung des Völkerrechts war das revolutionär.

Für die Juristin war die Konvention in den 1950er Jahren "revolutionär" für die Entwicklung des Völkerrechts.
Was hat die Konvention erreicht?
Angelika Nußberger: 1959 wurde der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) geschaffen, um die Einhaltung der Konvention sicherzustellen. An ihn kann sich seither jedermann, wenn die innerstaatlichen Rechtswege erschöpft sind, mit Beschwerden über Menschenrechtsverletzungen wenden. Der EGMR legt die Konvention als "living instrument" aus, als lebendigen Vertrag. Deren Ideen sind also nicht in Stein gemeißelt, sondern werden der Gesellschaftsentwicklung angepasst. Das wird zum Beispiel deutlich an den Urteilen zur Einstufung der Prügelstrafe als unmenschliche und erniedrigende Behandlung oder zur Gleichbehandlung von ehelichen und nichtehelichen Kindern. Die dynamische Auslegung hat es ermöglicht, immer wieder Antworten auf moderne Herausforderungen wie etwa den Klimawandel zu geben.
Gibt es weitere Fortschritte?
Angelika Nußberger: Ja, inzwischen wird der Gerichtshof auch vermehrt in Streitigkeiten zwischen Staaten tätig. Diese Kompetenz hatte er von Anfang an, doch sie blieb lange weitgehend ungenutzt. Aufgrund der Vielzahl militärischer Auseinandersetzungen, vor allem im postsowjetischen Raum, ist sie sehr wichtig geworden: Menschenrechtsverletzungen durch Russland im Ukrainekrieg oder im Kaukasuskrieg konnten so vor Gericht gebracht und abgeurteilt werden.
2011 gab es einen Höchststand von 160.000 anhängigen Fällen. Ist der EGMR Opfer seines Erfolgs geworden?
Angelika Nußberger: Das kann man so sagen. Ein Problem ist, dass die Mitgliedstaaten das Budget des Gerichtshofs kaum erhöht haben. 2025 lag es bei 88,5 Millionen Euro, was - so wird kolportiert - in etwa dem entspricht, was der Gerichtshof der Europäischen Union in Luxemburg für seine Bibliothek zur Verfügung hat. Weil jeder Mitgliedstaat einen Richter oder eine Richterin stellt, kann ihre Gesamtzahl auch nicht einfach steigen, sondern sie müsste verdoppelt werden. Dem Gerichtshof bleibt also nur, durch Verbesserung seiner Arbeitsmethoden schneller und effektiver zu werden. Das ist ihm gelungen, etwa durch Pilotverfahren, bei denen gleichgerichtete Klagen zusammengefasst und nur einzelne - beispielgebend - entschieden werden. Auch die Einführung von "single judges", die unzulässige oder offensichtlich unbegründete Beschwerden abweisen können, brachte Erleichterungen. Dennoch ist die Arbeitslast mit jährlich etwa 60.000 Beschwerden weiterhin hoch.
„In Staaten, die Menschenrechte nicht ausreichend achten, ist der Gerichtshof womöglich die einzige Hilfe für die betroffenen Menschen.“
Klagen aus Russland fallen nun jedoch weg. Im September 2022 ist das Land aus der Menschenrechtskonvention ausgetreten.
Angelika Nußberger: Ein Viertel der Klagen, die pro Jahr beim Gerichtshof eingingen, stammte aus Russland. Das Land gehörte - so wie die Türkei, die Ukraine und auch Rumänien - zu den Staaten, aus denen die meisten Beschwerden kamen. Der Gerichtshof behandelt Beschwerden, die bis zu sechs Monate nach Russlands Austritt oder Ausschluss - das kann man unterschiedlich sehen - eingegangen sind, allerdings weiter. Sie machen immer noch 13 Prozent der anhängigen Fälle aus.
Russland führt Krieg gegen die Ukraine, autokratische Tendenzen nehmen zu. Dabei sollte die Menschenrechtskonvention ein Bollwerk gegen Krieg, Diktatur und Menschenrechtsverletzungen sein. Ist sie an ihrer zentralen Aufgabe gescheitert?
Angelika Nußberger: Misst man sie an diesem Ziel - ja, zumindest bezogen auf Russland. Allerdings ist es gewagt anzunehmen, sie könnte den Ausbruch neuer Kriege in Europa verhindern. Der Völkerbund konnte den Zweiten Weltkrieg nicht abwenden, und auch der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ist nicht so erfolgreich darin, Kriege und militärische Auseinandersetzungen zu verhindern, wie wir uns das wünschen. Der Gerichtshof stemmt sich mit seinen Urteilen gegen Entwicklungen wie etwa in Georgien, doch stoppen kann er sie nicht.

Warum nicht?
Angelika Nußberger: Laut Artikel 58 kann jeder Staat - nach Einhaltung einer Kündigungsfrist - jederzeit aus der Konvention austreten. Dagegen gibt es rechtlich keine Handhabe. Die Reißleine haben bisher aber nur Griechenland während der Militärdiktatur und Russland nach dem Beginn der militärischen Aggression gegen die Ukraine gezogen.
Auch die Sanktionsmöglichkeiten sind beschränkt, wenn Staaten Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte missachten.
Angelika Nußberger: Es gibt eine wirkmächtige Sanktion: Der Europarat kann Staaten ausschließen. Nur ist das eine Sanktion, zu der man in der Regel nicht greifen will. Denn in Staaten, die Menschenrechte nicht ausreichend achten, ist der Gerichtshof womöglich die einzige Hilfe für die betroffenen Menschen. Im Fall des türkischen Mäzens Osman Kavala etwa, dessen Gefängnisstrafe der Gerichtshof 2019 als Verstoß gegen die Menschenrechtskonvention verurteilt hat, wurde seitens des Europarats zwar ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die Türkei eingeleitet - konkret ging es darum, die Umsetzung des Urteils durch den Gerichtshof selbst zu überprüfen. Doch trotz des negativen Ausgangs war der Ausschluss der Türkei letztlich politisch nicht gewollt.
Für den Gerichtshof bedeutet der Ausschluss eines Mitglieds aufgrund fehlender Beitragszahlungen finanzielle Einbußen. Gäbe es bessere Vollstreckungsmechanismen?
Angelika Nußberger: Der potenzielle Wegfall von Beitragszahlungen ist nicht entscheidend. Wichtig ist, dass das ganze System allein auf gutem Willen beruht. Mit der Ratifizierung der Konvention gibt der einzelne Staat Souveränität ab. Es ist ein Zugeständnis, Menschenrechtsschutz gemeinsam zu gestalten und Kontrolle von außen zuzulassen. Mit dem Zugehörigkeitsgefühl zu dieser Menschenrechtsgemeinschaft in Europa ist viel mehr geschaffen worden, als man je erhofft und erwartet hatte. Aber Staaten, die nicht mehr mitmachen wollen, wird man kaum zurückgewinnen können, es sei denn, es gäbe intern einen Politikwechsel.
Das regelt die Menschenrechtskonvention
🏛️ Die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) ist das Kernstück des Menschenrechtsschutzes in Europa und erhält einen Katalog an Grundrechten, wie das Recht auf Leben, das Verbot von Folter und die Freiheit der Meinungsäußerung.
✒️ Der Vertrag zwischen den Mitgliedstaaten des Europarats wurde am 4. November 1950 von 13 Staaten, darunter Deutschland, in Rom unterzeichnet und trat 1953 in Kraft. Später ergänzte Zusatzprotokolle betreffen unter anderem das Recht auf Bildung und die Abschaffung der Todesstrafe.
👥 Die EMRK ist seit 1953 in Kraft und gilt heute für mehr als 700 Millionen Menschen in den 46 Mitgliedstaaten des Europarats.
⚖️ Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR), nicht zu verwechseln mit dem Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH), wurde 1959 eingerichtet, um die Einhaltung der in der Konvention verankerten Grundrechte sicherzustellen. Sein Sitz ist in Straßburg.
📜 Beschwerden beim EGMR einreichen können einzelne Personen sowie Personengruppen, wenn die innerstaatlichen Rechtswege ausgeschöpft sind. Klagen können aber auch Staaten. Die gefällten Urteile sind für die betroffenen Staaten bindend und haben Regierungen schon häufig dazu veranlasst, ihre Gesetze oder ihre Verwaltungspraxis zu ändern.
Staaten wehren sich auch immer wieder gegen die Einflussnahme von "außen". Der Gerichtshof überspanne seine Zuständigkeit, heißt es oft. Ist da etwas dran?
Angelika Nußberger: Es ist in der Tat ein Dauerstreit, wie weit der Gerichtshof mit der Auslegung der einzelnen Artikel gehen darf. Grund dafür ist, dass er die Konvention, wie schon erklärt, im Licht gegenwärtiger Entwicklungen interpretiert. Wenn er sie dabei auf neue Sachverhalte anwendet, erstreckt er seine Zuständigkeit auf etwas, was vielleicht nicht vorhergesehen war. Klimaschutz etwa war kein Thema in den 1950er Jahren. Auf Grundlage des sehr allgemein formulierten Artikels 8, der den "Respekt für das Privatleben" einfordert, hat der Gerichtshof zu sehr vielen Fragen, von Euthanasie bis zu den Rechten von Transsexuellen, Antworten gegeben. Das wird mit dem Erstarken populistischer Parteien zunehmend kritisiert. Doch Interpretation bedeutet auch Fortentwicklung. Sonst würde das Recht nicht lebendig sein.
Im Mai haben neun Staaten auf Initiative Dänemarks und Italiens den Gerichtshof in einem offenen Brief für seine Rechtsprechung zum Migrationsrecht angegriffen und auf eine Überprüfung der Menschenrechtskonvention gedrängt. Ist das eine neue Qualität der Kritik?
Angelika Nußberger: Ja, und das ist wirklich besorgniserregend. Denn diese Kritik wird nicht von den Staaten formuliert, die Urteile des Gerichtshofs bekanntermaßen ignorieren, wie die Türkei oder Aserbaidschan, oder die der Konvention schon in der Vergangenheit kritisch gegenüberstanden, wie die Schweiz oder Großbritannien; dort ist der Austritt aus der Konvention sogar ein wesentliches Ziel im Wahlkampf der Tories. Nein, die Kritik kommt von Staaten, die das europäische Menschenrechtssystem ernstnehmen und von denen ich nicht annehmen würde, dass sie es unterminieren wollen.
Der Vorwurf lautet, die Konvention mache es schwer, "kriminelle Ausländer" abzuschieben. Ist er berechtigt?
Angelika Nußberger: Die Rechtsprechung zur Migration hat sich über Jahrzehnte entwickelt und wurde von den Staaten in der Vergangenheit zwar kritisiert, aber im Wesentlichen toleriert. Doch die politische Lage hat sich, nicht zuletzt aufgrund der populistischen Strömungen, geändert. Für den Gerichtshof ist das ein Dilemma: Als "Gewissen Europas" soll er seine Stimme einerseits erheben, wenn die Menschenrechte verletzt werden, und das betrifft auch die Menschenrechte derer, die straffällig geworden sind. Andererseits ist er auf die Akzeptanz seiner Urteile durch die Mitgliedsstaaten angewiesen. Auf den Vorwurf, "ultra vires", also jenseits seiner Befugnisse, zu handeln, muss er daher eine gute Antwort finden.
Wie lässt sich das europäische Menschenrechtssystem vor einem Backlash bewahren?
Angelika Nußberger: Wir dürfen die Krisenphänomene nicht überbetonen: Das System hat sich selbst in schwierigen Zeiten wie dem Kalten Krieg bewährt und ist zu Recht als Erfolgsmodell gefeiert worden. Die Politik sollte sich bewusst sein, dass man ein solches Juwel schützen muss. Ein zweites Mal ließe es sich nicht mehr aufbauen.
Auch lesenswert

Experten mahnen in einer Anhörung im Menschenrechtsausschuss, die Institutionen des europäischen Menschenrechtsregimes zu stärken.

Der Beitritt zum Europarat führte Deutschland zurück in die europäische Wertegemeinschaft. Die Historikerin Birte Wassenberg über alte Ziele und neue Themen.

Vor 75 Jahren wurde der Europarat gegründet: Am Anfang stand die Zusammenarbeit in Europa im Zentrum, heute Demokratie und Schutz der Menschenrechte. Ein Überblick.