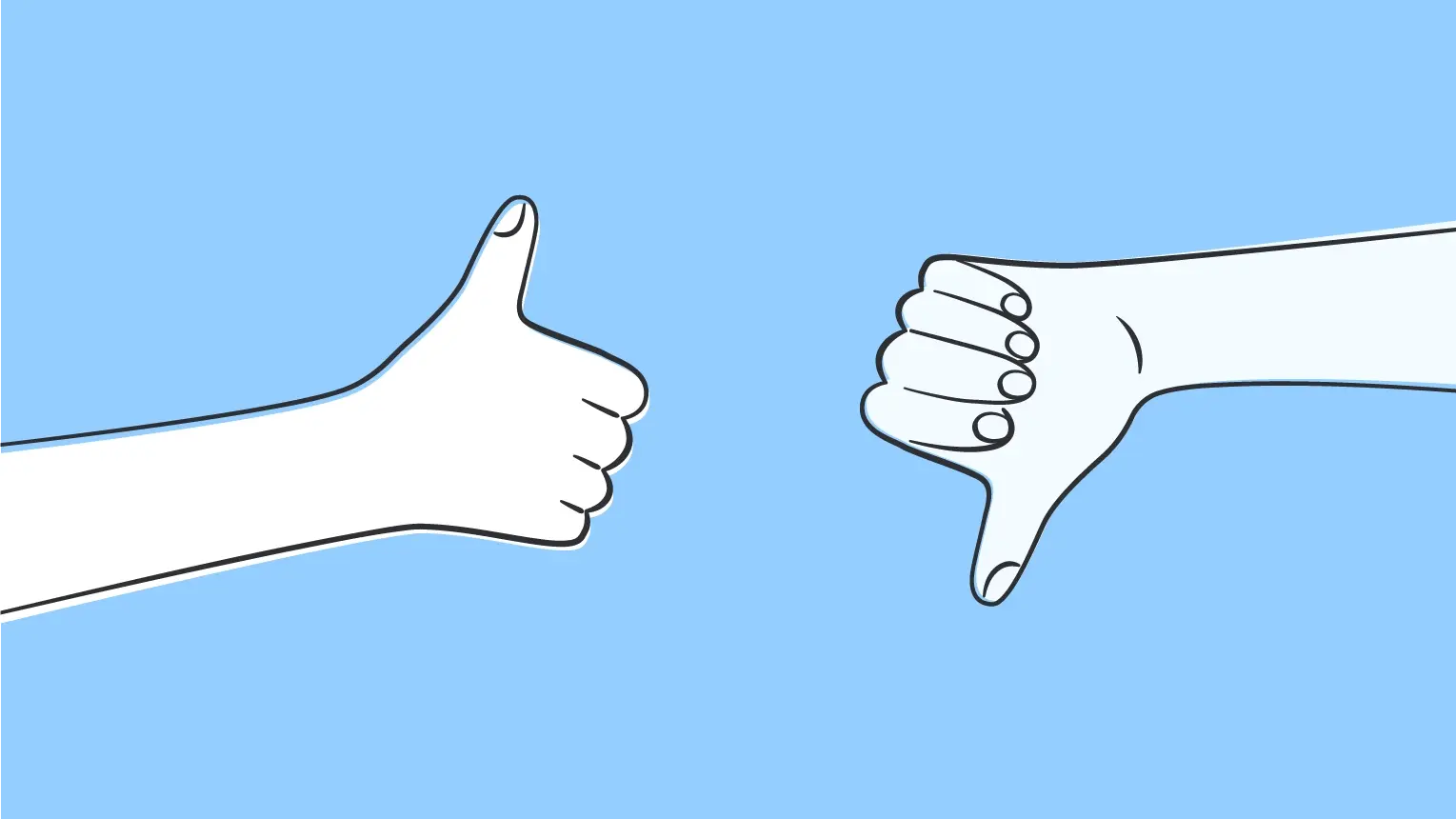
Gastkommentare : Konventionell stärkste Armee Europas? Ein Pro und Contra
Braucht Deutschland die konventionell stärkste Armee Europas? Markus Decker findet die Ankündigung des Kanzlers richtig, Stephan Hebel nicht: ein Pro und Contra.
Pro
Eine militärische Stärkung Deutschlands ist notwendig für die Sicherheit Europas

Wer die Ankündigung des neuen Bundeskanzlers Friedrich Merz, wonach Deutschland die konventionell stärkste Armee Europas bekommen solle, mit den Debatten nach der Vereinigung 1990 vergleicht, dem fährt der Schreck in die Glieder. Damals wurde die Bundeswehr systematisch geschrumpft. Und die politisch Verantwortlichen vermieden noch ihren harmlosesten Auslandseinsatz. Nichts sollte nach Dominanz aussehen. Trotzdem hat der CDU-Politiker recht.
Die außenpolitischen Rahmenbedingungen haben sich radikal verändert. Russland agiert unter Wladimir Putin aggressiv. Auf die USA ist unter Donald Trump kein Verlass. So wächst die Notwendigkeit, in Verteidigung zu investieren, gleich doppelt.
Hinzu kommt, dass unsere Nachbarn die militärische Stärkung Deutschlands überwiegend nicht mehr fürchten, sondern sie begrüßen. Das gilt besonders für die Staaten östlich unserer Landesgrenzen. In Litauen etwa erwarten die Menschen sehnsüchtig jene ständige Bundeswehr-Brigade, die das kleine Land zwischen der russischen Exklave Kaliningrad und Belarus schützen soll. Sie blicken auf die Deutschen so, wie viele Deutsche nach 1945 auf Amerikaner, Briten und Franzosen blickten - als Garanten der Freiheit.
Natürlich fehlt es bisher an einer entscheidenden Ressource, um Merz' Plan in die Tat umzusetzen: an genug Soldatinnen und Soldaten. Überdies gibt es keine Garantie dafür, dass eine Regierung in fernerer Zukunft mit einer gestärkten Bundeswehr nicht etwas anderes im Schilde führen könnte, als sie in den Dienst des Kontinents zu stellen. Doch heute ist das Risiko ein anderes: Dass die Europäische Union auseinanderfällt, wenn ihre großen Mitgliedstaaten nicht die Führung übernehmen. Dieses Risiko ist ungleich größer.
Contra
Die "konventionell stärkste Armee Europas" kann nur eine europäische sein

Es wäre unfair, dem Bundeskanzler einen Hang zu nationalen Alleingängen nachzusagen. "Eine Außen- und Sicherheitspolitik, die einem starken Europa dient" hat Friedrich Merz in seiner ersten Regierungserklärung versprochen. Gerade deshalb wirkt es einigermaßen fragwürdig, dass er zugleich das Ziel ausrief, die deutsche Bundeswehr "zur konventionell stärksten Armee Europas" zu machen.
Nicht verwunderlich ist, dass diese Aussage bei Merz in ein Bekenntnis zur politischen Logik der Abschreckung eingebettet ist. Wenn er von "Stärke" spricht, dann ist nicht von der Kraft die Rede, die notwendig wäre, sich jenseits unbestritten notwendiger Verteidigung eine Zukunft wenigstens vorzustellen, in der friedliche Koexistenz auf etwas anderem beruht als auf militärischer Wettbewerbsfähigkeit. Damit allerdings steht der Kanzler und CDU-Vorsitzende keineswegs allein, es lässt sich hinzufügen: leider.
Aber selbst wer der Abschreckungslogik folgt, sollte an die Formulierung von der "konventionell stärksten Armee Europas" ein Fragezeichen setzen. Sie steht nämlich in offensichtlichem Widerspruch zu den europäischen Bekenntnissen, die ihr nicht nur in der Regierungserklärung vorausgegangen waren. Wer diese ernst meint, sollte nicht die Stärke der eigenen Armee ins Verhältnis zu den Streitkräften anderer setzen, die dann logischerweise "schwächer" wären. Denkt man die Aussage des Kanzlers zu Ende, bedeutet sie die Fortsetzung und Festschreibung des aktuellen und teuren Missstands, dass nationale Armeen in Europa nebeneinander oder gar in Konkurrenz zueinander existieren.
Wer sich zu Europa bekennt, sollte bedenken: Auch militärische Stärke gewinnt dieser Kontinent auf lange Sicht nur durch gemeinsame Verteidigung. Die "konventionell stärkste Armee Europas", wenn man ihr schon das Wort redet, kann nur eine europäische sein, keine deutsche.

Die neue Bundesregierung will die Bundeswehr massiv aufrüsten. Am Geld mangelt es nach der Aufweichung der Schuldenbremse nicht - aber an Soldaten.
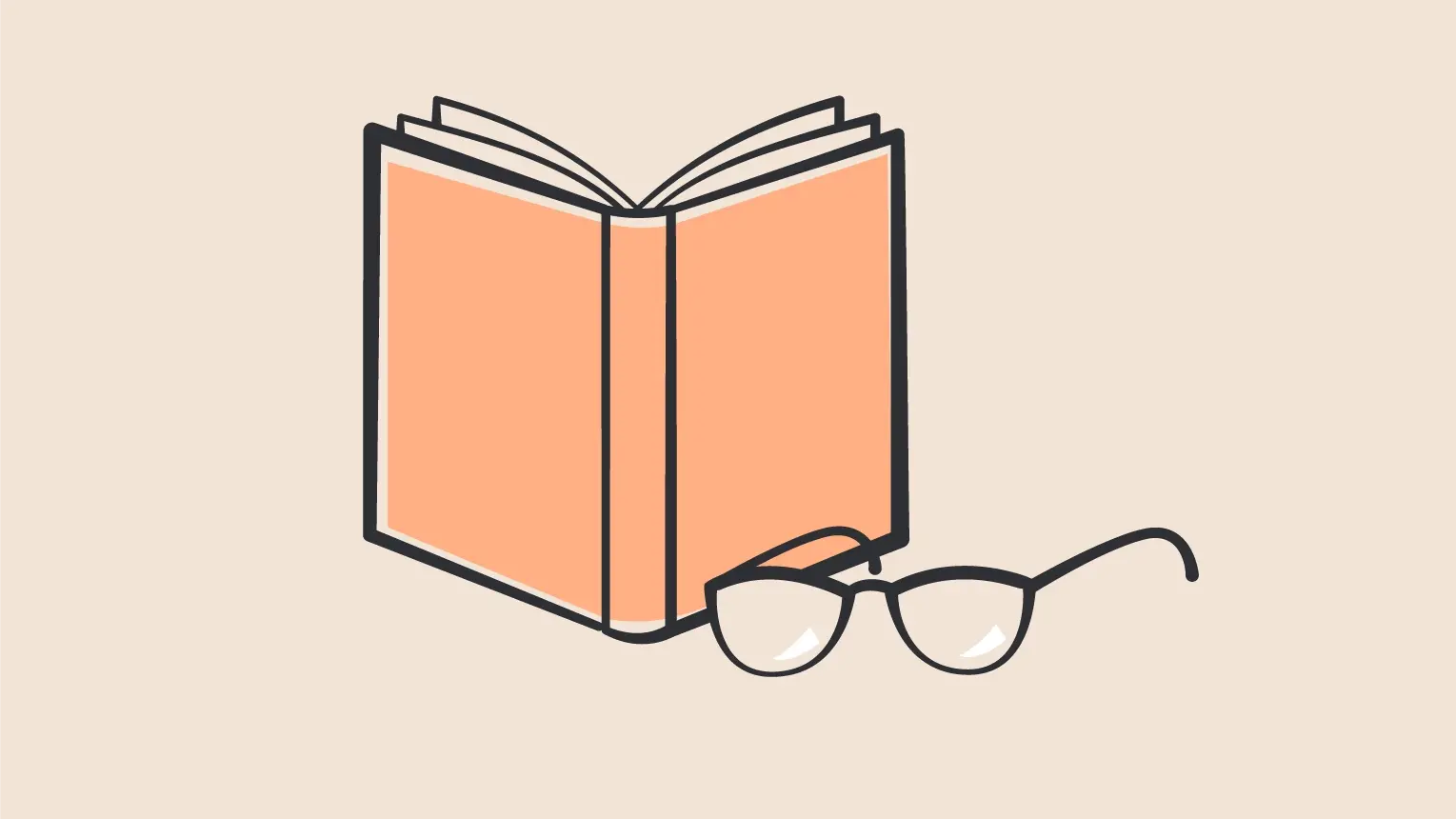
Der Militärhistoriker Sönke Neitzel blickt in seinem neuen Buch zurück auf 70 Jahre Bundeswehr. Und er fordert ein Umdenken in der Verteidigungspolitik.

Zum Ende der Amtszeit mahnt die Wehrbeauftragte Eva Högl das Personalproblem erneut als das größte Problem der Bundeswehr an - und befeuert die Wehrpflicht-Debatte.