Soziologe Özgür Özvatan im Interview : "Das Potenzial von Migrantengruppen wird massiv unterschätzt"
Özgür Özvatan schreibt in seinem Buch "Jede Stimme zählt" über Wähler mit Migrationshintergrund und die Versäumnisse der etablierten Parteien bei ihrer Ansprache.
Herr Özvatan, in Ihrem Buch "Jede Stimme zählt" bezeichnen Sie Wählerinnen und Wähler mit Migrationshintergrund als "Game Changer". Was meinen Sie damit?
Özgür Özvatan: Mehreres. Einerseits ist der Wettbewerb zwischen den Parteien sehr eng: Was hätten die Grünen oder die SPD bei der letzten Bundestagswahl schon allein für zwei Prozentpunkte gegeben? Zugleich geht es um sehr viele Menschen: Dieses Jahr hatten 16,6 Prozent der Wahlberechtigten einen Migrationshintergrund, 2029 dürften es 25 bis 30 Prozent sein. Dahinter stecken Entwicklungen wie Einbürgerungen und das Erreichen des Wahlalters einer Generation, in der über 40 Prozent einen Migrationshintergrund haben. In der Gesamtbevölkerung trifft das schon jetzt auf 30 Prozent zu.
Wird dieses Potenzial von den Parteien richtig eingeschätzt?
Özgür Özvatan: Es wird massiv unterschätzt. Natürlich wählen Migrantengruppen nicht en bloc eine Partei. Aber ein Zulauf von fünf Prozent wäre gut möglich, wenn etwa ein konservatives oder progressives Drittel gezielt angesprochen würde. Ein Grund für das Unterschätzen ist, dass Abgeordnete laut einer Vergleichsstudie zwischen sechs westlichen Ländern ihr Bild von der öffentlichen Meinung vor allem aus drei hochselektiven Quellen beziehen: dem Bekanntenkreis, Gesprächen im Wahlkreisbüro und Qualitätsmedien. Diese Selektivität führt zu einer verzerrten Wahrnehmung. Diese könnte durch repräsentative Umfragen und Erkenntnisse rejustiert werden - aber offenbar sind diese als Quellen für Abgeordnete kaum relevant. So bleiben die Probleme verschiedener Wählergruppen strukturell ausgeblendet, insbesondere die der Wähler mit Migrationshintergrund.
„Insbesondere die AfD spricht programmatisch ganz gezielt verschiedene Migrantengruppen an.“
Was folgt daraus?
Özgür Özvatan: Die Missverständnisse beginnen schon damit, was diese Menschen umtreibt. Viele Parteien folgen dem Irrglauben, sie seien vor allem an integrationspolitischen Fragen interessiert. Das ist falsch. Eine Umfrage des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM) mit Sitz in Berlin hat gezeigt: Auch für diese Gruppen sind vor allem Themen wie Sicherheit, Wirtschaft und Arbeit zentral.
Aber diese Politikfelder bespielen die Parteien doch. Müssten sie Wähler mit Migrationshintergrund nicht automatisch erreichen?
Özgür Özvatan: Nein, weil die demokratischen Parteien versäumen, sie zielgruppenspezifisch zu adressieren. Gehen Politikerinnen und Politiker zu einer Gewerkschaft oder einem Arbeitgeberverband, passen sie ihre "Talking Points" stets treffsicher an. Bei Russlanddeutschen, Türkeistämmigen, muslimischen oder Schwarzen Menschen passiert das kaum - in der digitalen Welt noch weniger als in der analogen. Dabei bietet diese dank ihrer algorithmischen Funktionsweise die Chance, in kürzester Zeit bestimmte Gruppen gezielt anzusprechen.

Gilt die mangelnde Ansprache von Menschen mit Migrationshintergrund für alle Parteien?
Özgür Özvatan: Nein, insbesondere die AfD spricht programmatisch ganz gezielt verschiedene Migrantengruppen an. Wenn AfD-Abgeordnete im russischen Staatsfernsehen sprechen oder sich in Deutschland als Putin-Versteher äußern, zielt das klar auf eine russlandnahe Klientel. Auch andere Gruppen finden auf Tik Tok & Co. eine ganze Reihe Videos, in denen sich Politiker wie Maximilian Krah schützend vor Staatsmänner wie Erdogan stellen, oder in Clips für Türkeistämmige gezielt konservative bis queerfeindliche Familienwerte betonen, etwa nach dem Motto: "Wollt ihr, dass eure Kinder ,umgedreht' werden? Wir sind die, die das verhindern können." So kombiniert die AfD inhaltliche Nachfrage und Community-Ansprache.
Und so kann eine ansonsten migrationsfeindliche Partei bei diesen Wählern punkten?
Özgür Özvatan: Wer selbst zugewandert ist, ist nicht automatisch für weitere Zuwanderung. Außerdem kommuniziert die AfD gezielt in eine migrantisch-konservative bürgerliche Mitte hinein, die von den etablierten Parteien nicht angesprochen wird. Und sie setzt - erfolgreich - darauf, dass der hochoptimierte Algorithmus von TikTok diese Inhalte organisch in die adressierten Räume trägt.
Auch der Partei Die Linke wurde ein geglückter digitaler Bundestagswahlkampf attestiert.
Özgür Özvatan: Ja, sie hat - weit über die TikToks von Heidi Reichinnek hinaus - überraschend gut performt. Sie hat zum Beispiel auch gute Beispiele für einen hybriden Wahlkampf geboten: Ferat Koçak, der das erste Direktmandat außerhalb Ostdeutschlands holte, ist in Berlin-Neukölln von Haustür zu Haustür gegangen, und hat das digital verbreitet. Das ist nicht zuletzt sehr ressourceneffizient. Die Linke hat es auch verstanden, politische Botschaften mit dem Zeitgeist von Plattformen zu verbinden. Es gab Kurzvideos mit einem tanzenden Gregor Gysi, die zugleich eine politische Message bieten. Von Olaf Scholz gabt es etwas Ähnliches: Er steht neben dem tanzenden schwarzen TikToker Brooklyn, ohne jedoch eine politische Botschaft zu verbreiten. Doch die Erfolgsformel lautet eben nicht "Entertainment statt Message". Sondern “Entertainment mit Message.”
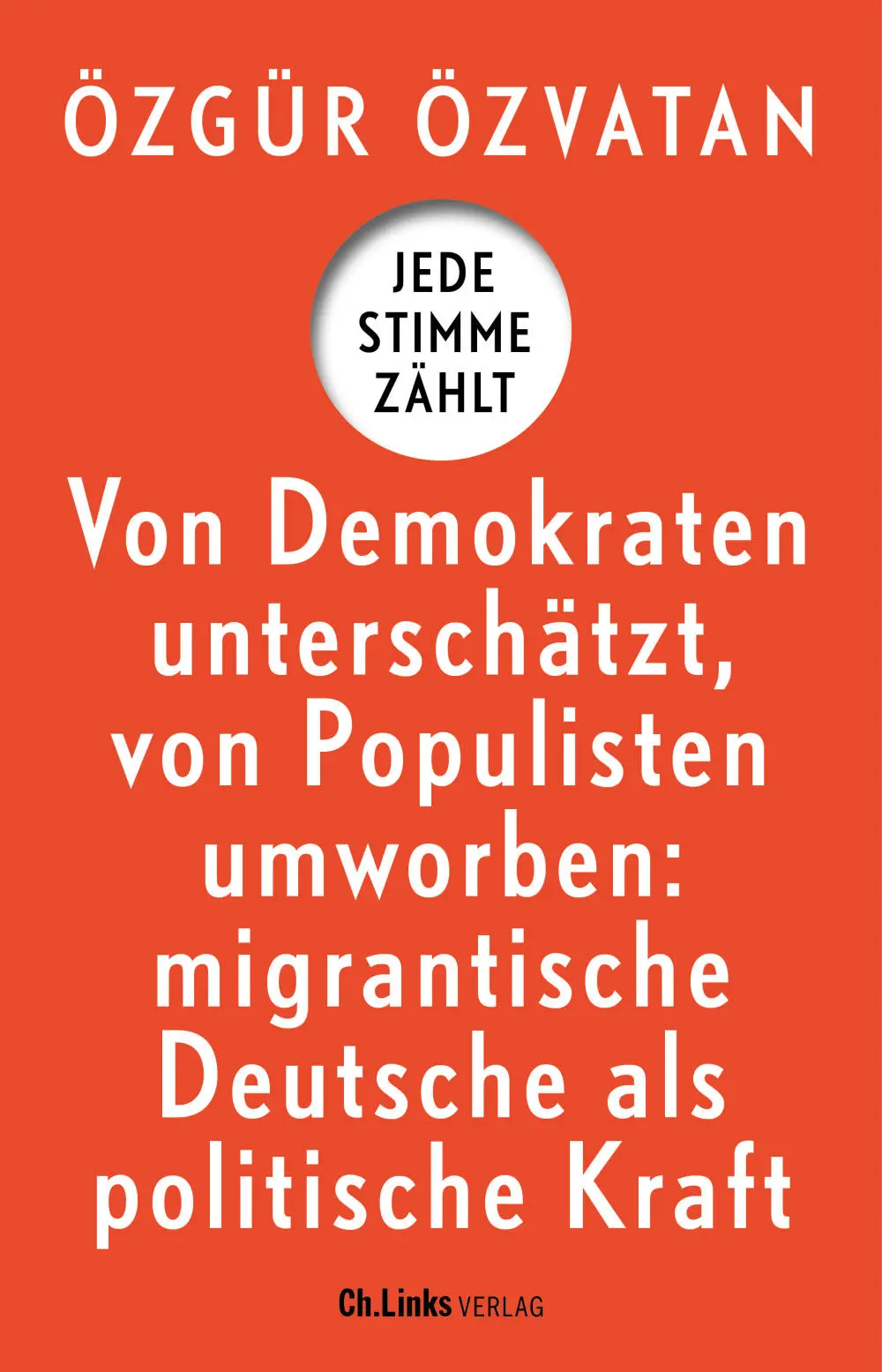
Özgür Özvatan:
Jede Stimme zählt.
Von Demokraten unterschätzt, von Populisten umworben: migrantische Deutsche als politische Kraft.
Ch. Links Verlag,
Berlin 2025;
200 S., 20,00 €
Warum bekommen die einen eine attraktive digitale Ansprache hin, die anderen nicht?
Özgür Özvatan: Zum einen kann eine Partei wie Die Linke mit radikaleren Forderungen stärker emotionalisieren. Das bringt algorithmische Vorteile: Je häufiger Nutzerinnen und Nutzer liken und kommentieren, desto stärker verbreiten sich Inhalte. Das heißt aber nicht, dass Parteien der Mitte chancenlos sind. Eine große Rolle spielt, dass diese mit Beratungsagenturen arbeiten, die ebenfalls noch nicht in der Realität einer migrantischeren Wählerschaft angekommen sind. Ein Paradebeispiel dafür, was passiert, wenn weder die Abgeordneten noch die Dienstleister die diversifizierten Lebenswelten verstehen, ist ein zwei Tage vor der Wahl von Robert Habeck gepostetes Foto, das ihn mit Annalena Baerbock auf einem "Döner-Date" zeigt. Der Kommentar: "Einmal Wahlkampf mit alles und scharf". Mehr Cringe, mehr Fremdscham, ist kaum möglich - und so erzeugt man mehr Abwanderung als Zulauf.
Auch bei der Repräsentation hinkt der Deutsche Bundestag statistisch hinterher: Laut Mediendienst Integration haben 11,6 Prozent der Abgeordneten einen Migrationshintergrund - gegenüber rund 30 Prozent in der Bevölkerung. Worauf führen Sie das zurück?
Özgür Özvatan: Alle etablierten Parteien tun sich mit der Rekrutierung von Migrantinnen und Migranten schwer. Ein häufiges Problem ist, dass die, die in die Politik einsteigen, sich mit der Unterstellung konfrontiert sehen, "ethnische Klientelpolitik" zu betreiben. Sie stehen ständig zwischen der Frage, Integrations- oder anderweitige Fachpolitik zu betreiben, statt beides zusammenzudenken. Das führt zu Reibungsverlusten: Laut einer Studie der Robert-Bosch-Stiftung bleiben Abgeordnete mit Migrationshintergrund im Schnitt vier Jahre kürzer im Parlament, über 80 Prozent verlassen den Bundestag unfreiwillig.
In Ihrem Buch spielen Sie mit der Idee einer "postmigrantischen Partei". Halten Sie das für realistisch?
Özgür Özvatan: Ich halte es für möglich. Allerdings geht es dabei nicht um eine "migrantische" Partei, sondern um eine "postmigrantische".
Mehr zu Wahlmilieus lesen

Ansgar Hudde hat die letzten beiden Bundestagswahlen analysiert. Seine These: Die Mehrheit der Deutschen lebt in politisch heterogenen Nachbarschaften.
Was bedeutet das?
Özgür Özvatan: Eine solche Partei würde ein progressives, plurales Angebot für alle machen - ob mit oder ohne Migrationsgeschichte; passend dazu, dass unsere Lebenswelten ohnehin sehr verwoben sind. Sie könnte all jene binden, die von den "Wenn und Abers" der etablierten Parteien frustriert sind und eine radikale Verteidigung der im Grundgesetz verankerten offenen und pluralen Demokratie fordern. Ich halte nicht für ausgeschlossen, dass eine solche Partei auf Anhieb zehn bis 15 Prozent erreichen könnte, also in etwa so viele wie Grüne oder SPD. Und sollten die demokratischen Parteien die Nachfrage in progressiven Wählergruppen weiterhin nicht bedienen, könnte eine solche Partei womöglich sogar über 20 Prozent klettern. Das würde zu einer tektonischen Verschiebung im Parteienspektrum führen.
Sehen Sie eine Chance für die demokratischen Parteien, das Ruder herumzureißen und diese Wählergruppen zu erreichen?
Özgür Özvatan: Ja, das ist die positive Botschaft: Die Versäumnisse liegen bei den demokratischen Parteien. Also liegt auch der Hebel in ihrer Hand - allerdings womöglich nicht mehr lange. Nötig dafür wäre, dass die Parteien sich einem Dreiklang der Transformation unterziehen: von einem Bewusstsein über die postmigrantische Wählerschaft über die systematische Integration von Community-Wissen bis hin zu einem passgenauen inhaltlichen und kommunikativen Angebot.