Vor 65 Jahren : Ende der Wohnungszwangswirtschaft beschlossen
Nach dem Krieg regelte der Staat das Wohnungswesen, denn groß war die Wohnungsnot. 1960 änderte sich das: Fortan sollte der Markt für ausreichend Wohnraum sorgen.
Nach dem Zweiten Weltkrieg herrschte in Deutschland akute Wohnungsnot. Als die Bundesrepublik gegründet wurde, standen den knapp 15 Millionen Haushalten nur rund neun Millionen Wohnungen zur Verfügung, Behelfsunterkünfte eingerechnet. Der Zuzug von Vertriebenen verschärfte die Situation noch.
Die Siegermächte führten daher die seit 1936 geltende Wohnraumbewirtschaftung fort: Wohnungsbesitzer konnten über ihre Wohnungen nicht frei verfügen, stattdessen bestimmten Ämter die Belegung. Mieten blieben eingefroren, Kündigungen waren quasi unmöglich.
Parlament reagierte mit einem Wohnungsbaugesetz
1950 reagierte der Bundestag mit einem Wohnungsbaugesetz auf den Mangel. Es förderte durch Zuschüsse, etwa in Form zinsloser staatlicher Baudarlehen, und Steuervergünstigungen für Bauherren den sozialen Wohnungsbau. Bis 1960 entstanden mit staatlicher Unterstützung fünf Millionen Wohnungen. Zeit für eine Reform der Wohnungspolitik.
Am 24. Mai 1960 verabschiedete der Bundestag ein "Gesetz über den Abbau der Wohnungszwangswirtschaft und über ein soziales Miet- und Wohnrecht". Der Entwurf entspricht dem nach dem Bundesminister für Wohnungsbau, Paul Lücke (CDU), benannten Lücke-Plan. Sein Ziel: Der Staat sollte sich aus der Wohnraumregulierung zurückziehen, stattdessen sollte - ganz im Sinne der sozialen Marktwirtschaft - der Markt selbst für ausreichenden Wohnraum sorgen.
Gesetz sollte Restriktionen schrittweise abbauen
Das Gesetz sehe aber "nicht vor, die Wohnungswirtschaft ad hoc in die soziale Marktwirtschaft zu überführen", betonte Josef Mick (CDU) als Berichterstatter des federführenden Ausschusses für Wohnungsbau im Bundestag. "Vielmehr soll der Abbau der Wohnungszwangswirtschaft schrittweise in dem Maße erfolgen, wie die Wohnungsnot beseitigt ist." So sollte die Wohnraumbewirtschaftung in den Kreisen aufhören, in denen die statistische Wohnungsunterversorgung drei Prozent und weniger betrug.
Außerdem erlaubte das Gesetz Mieterhöhungen um bis zu 15 Prozent für Altbauwohnungen, die vor Juni 1948 bezugsfertig geworden waren. Ab 1. Januar 1966 sollte eine "endgültige Mietpreisfreigabe" folgen. Gleichzeitig novellierte das Gesetz aber auch das Mietrecht, so wurden beispielsweise Kündigungsfristen verlängert. Man sei der Ansicht gewesen, "dass, insbesondere bei langdauernden Mietverhältnissen, eine Kündigungsfrist von drei Monaten zu kurz sei", so Berichterstatter Mick.
Als Ausgleich für Mieterhöhungen sah das Gesetz Beihilfen vor
Fortan wurden Kündigungsfristen an die Länge der bestehenden Mietverhältnisse gekoppelt. "Sie sollen bei einem fünfjährigen Mietverhältnis sechs Monate betragen, bei einem achtjährigen Mietverhältnis neun Monate, bei einem Mietverhältnis von zehn und mehr Jahren zwölf Monate", erklärte Mick. Als Ausgleich für Mieterhöhungen sah das Gesetz Beihilfen vor, die nach Einkommensverhältnissen zu staffeln waren.
An ihre Stelle trat später das "Wohnungsgeld". Dennoch belasteten die Mietsteigerungen viele Haushalte. Der SPD-Abgeordnete Herbert Hauffe mahnte, dass es schon früher Mieterhöhungen in unerlaubtem Maße gegeben habe, "ohne dass dagegen Einspruch eingelegt wurde. Es gibt eben oft die Situation: Wo kein Kläger ist, da ist kein Richter".
Mehr zum Thema Wohnen lesen

Verena Hubertz (SPD) will durch serielles Bauen günstiger und schneller Wohnungen schaffen. Zudem kündigte die Ministerin eine Verlängerung der Mietpreisbremse an.
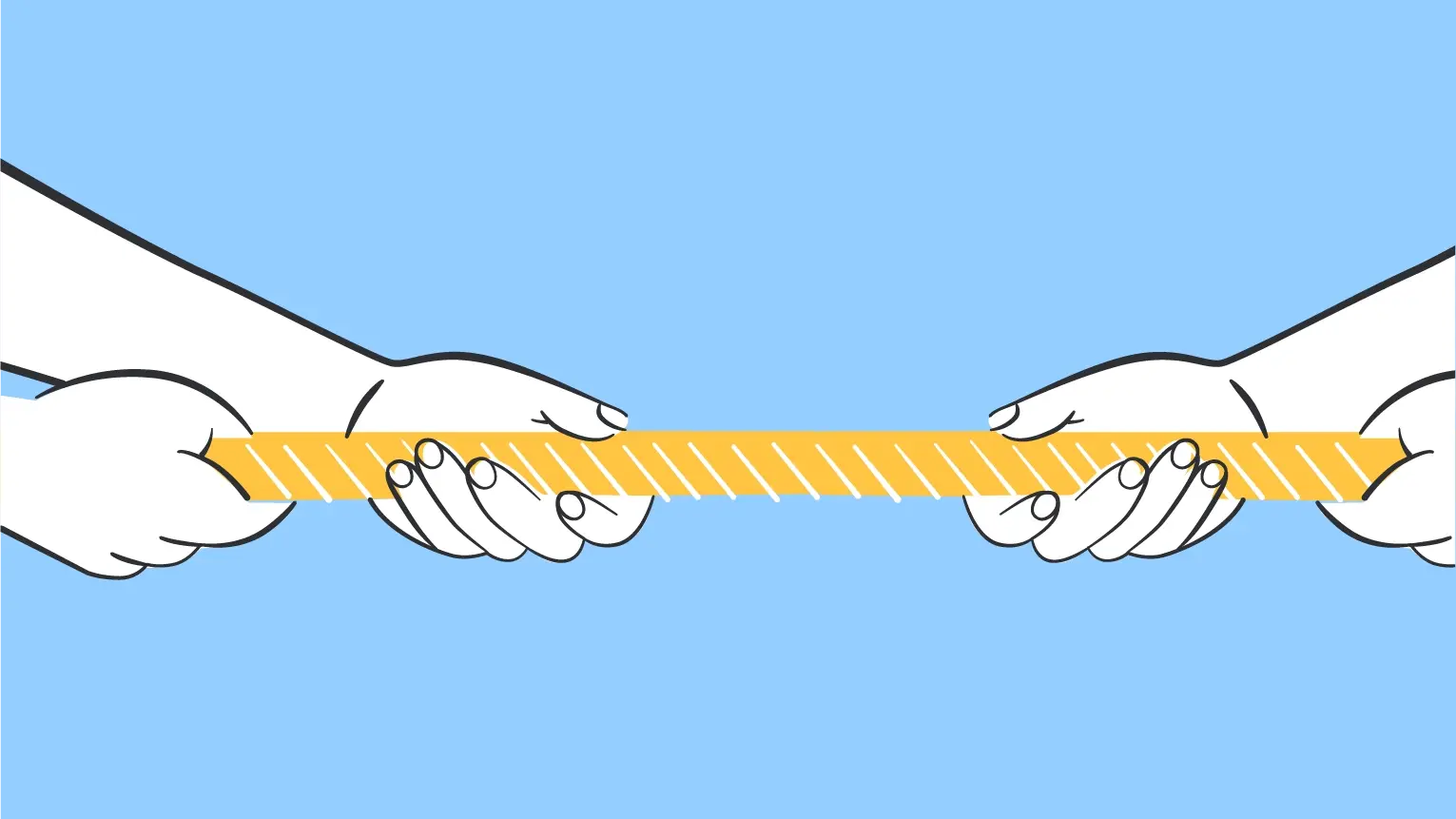
Wohnraum ist knapp. Doch sollte deshalb jede Möglichkeit genutzt werden, neue Wohnungen zu schaffen? Silke Kersting und Wolfgang Mulke im Pro und Contra.

Steigende Mieten, sinkendes Angebot: Das Thema bezahlbares Wohnen ist in der Mittelschicht angekommen. Die Fraktion Die Linke will das Mietrecht verschärfen.
