Diskussion beim "Forum W" : Nur gemeinsam für mehr europäische Unabhängigkeit
Europa muss sich verteidungs- und sicherheitspolitisch neu sortieren. Wie dies gelingen kann, darüber diskutierten drei Experten beim "Forum W" im Bundestag.
Am Dienstagnachmittag war der Europasaal nur ein paar Etagen über dem "Lampen-Laden", dem Mitarbeiter-Restaurant im Paul-Löbe-Haus, gut besucht. Von Schülerpraktikanten bis hin zu Abgeordneten waren viele Interessierte vor Ort. Denn es wurde wieder zum "Forum W" geladen. Das Thema lautete diesmal "Sicherheit 'Made in Europe': die Zukunft der Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik".

Unter der Moderation von Silke Albin (r.) diskutierten die Gastredner Herfried Münkler, Carolyn Moser und Benedikta von Seherr-Thoß (digital zugeschaltet) beim "Forum W" über die Einigkeit in der Frage der gemeinsamen europäischen Abschreckung.
Im Mittelpunkt der von Silke Albin, Leiterin der Abteilung Außenbeziehungen, Europa und Analyse beim Deutschen Bundestag, moderierten Diskussion standen grundlegende sicherheits- und verteidigungspolitische Weichenstellungen, die durch die EU-Initiative "Readiness 2030" und den "ReArm Europe Plan" umgesetzt werden sollen. Die Initiative skizziert das strategische Ziel einer europäischen Verteidigungsunion. "ReArm Europe" zielt auf die Finanzierung erhöhter Verteidigungsausgaben in Höhe von bis zu 800 Milliarden Euro ab. Jeder der drei Gäste hatte zunächst Zeit für ein Eingangsstatement, anschließend gab es noch Zeit für eine Fragerunde aus dem Publikum.
Europa befindet sich laut Münkler in einer “Sandwich-Rolle” zwischen Russland und USA
Zunächst ergriff Herfried Münkler das Wort, emeritierter Professor für Politikwissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin und Autor vieler politischer Standardwerke zur politischen Ideengeschichte. In seinem Statement sprach er davon, dass sich Europa in einer "Sandwich-Rolle" zwischen Russland und den USA befinde, was auf Dauer "sehr unkomfortabel" sei.
In der regelbasierten Weltordnung der Vergangenheit hätten lange Zeit die USA eine "Hüterrolle" innegehabt und nicht die Vereinten Nationen, wie viele denken würden. Durch die "America First"-Politik von US-Präsident Donald Trump sei diese aktuell jedoch nicht mehr vorhanden. Stattdessen gebe es eine Wiederkehr von "imperialen Akteuren" wie Wladimir Putins Russland oder dem China von Xi Jinping. Die "Europäer sind weitgehend auf sich allein gestellt", sagte Münkler. Daher müsse sich Europa die Frage stellen, ob es in einer multipolaren Welt ein Akteur sein wolle oder nicht.
„Die große Wende war nicht der Krieg in der Ukraine, die große Wende war Trump.“
Carolyn Moser, Forschungsgruppenleiterin am Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, betonte, dass Europa zu lange damit beschäftigt gewesen sei, "Frieden zu managen". Sie forderte eine bessere Kooperation der europäischen Parlamentarier. Durch die gemeinsame Arbeit seien auch die einzelnen Nationalstaaten besser geschützt: "EU-Verteidigung ist keine Bedrohung für nationale Souveränität, sondern ermöglicht diese", so Moser.
Trump sorgte für Umdenken der europäischen Sicherheitspolitik
Benedikta von Seherr-Thoß, leitende Direktorin für Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik sowie Krisenreaktion im Generalsekretariat des Europäischen Auswärtigen Dienstes, wurde aus Brüssel zugeschaltet. Sie betonte, dass es die Politik von US-Präsident Trump war, die zu einem Umdenken in der europäischen Sicherheitspolitik geführt habe: "Die große Wende war nicht der Krieg in der Ukraine, die große Wende war Trump."
Seherr-Thoß empfahl den Europäern, sich in Zukunft zu fragen, was es brauche, welche Projekte es bereits gebe und welche weiteren noch benötigt würden. Die 27 Mitgliedstaaten der EU, von denen 22 auch Nato-Mitglieder sind, müssten besser zusammenarbeiten und dafür alle möglichen EU-Instrumente ausschöpfen - zum Beispiel in der Rohstoffversorgung - lautete ihr Appell. Auf jeden Fall sei es gut, dass die EU der größte Unterstützer der Ukraine sei.
Experten fordern mehr einheitliche Zusammenarbeit in Europa
Vor dem Hintergrund des Krieges dort plädierte Münkler für eine gemeinsame nukleare Bewaffnung in Europa. Jedoch nur, wenn der Schutzschirm auch Länder wie Polen und die baltischen Staaten mit einbeziehe. Andernfalls könne es zu Unstimmigkeiten in Europa kommen, die in der aktuellen Situation verhindert werden müssten.
Auch Seherr-Thoß betonte, dass die EU ihre Verteidigungsfähigkeit schneller ausbauen müsse als es aktuell bis 2030 angedacht ist. Als einen Grund nannte sie, dass Russland aktuell einen starken Zulauf bei neuen Partnerschaften habe. Fazit des Forums: Nur gemeinsam und mit größtmöglicher Unabhängigkeit kann eine bessere europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik gelingen.
In diesem Sinne plädierte am Ende der Veranstaltung der Politikwissenschaftler Münkler für die Idee eines europäischen Generalstabs, der die Sicherheits- und Verteidigungspolitik auf dem Kontinent koordinieren könnte.

Ein überraschend harmonischer Nato-Gipfel ist mit einer historischen Vereinbarung zu Ende gegangen. Die Mitgliedstaaten wollen viel mehr Geld investieren.
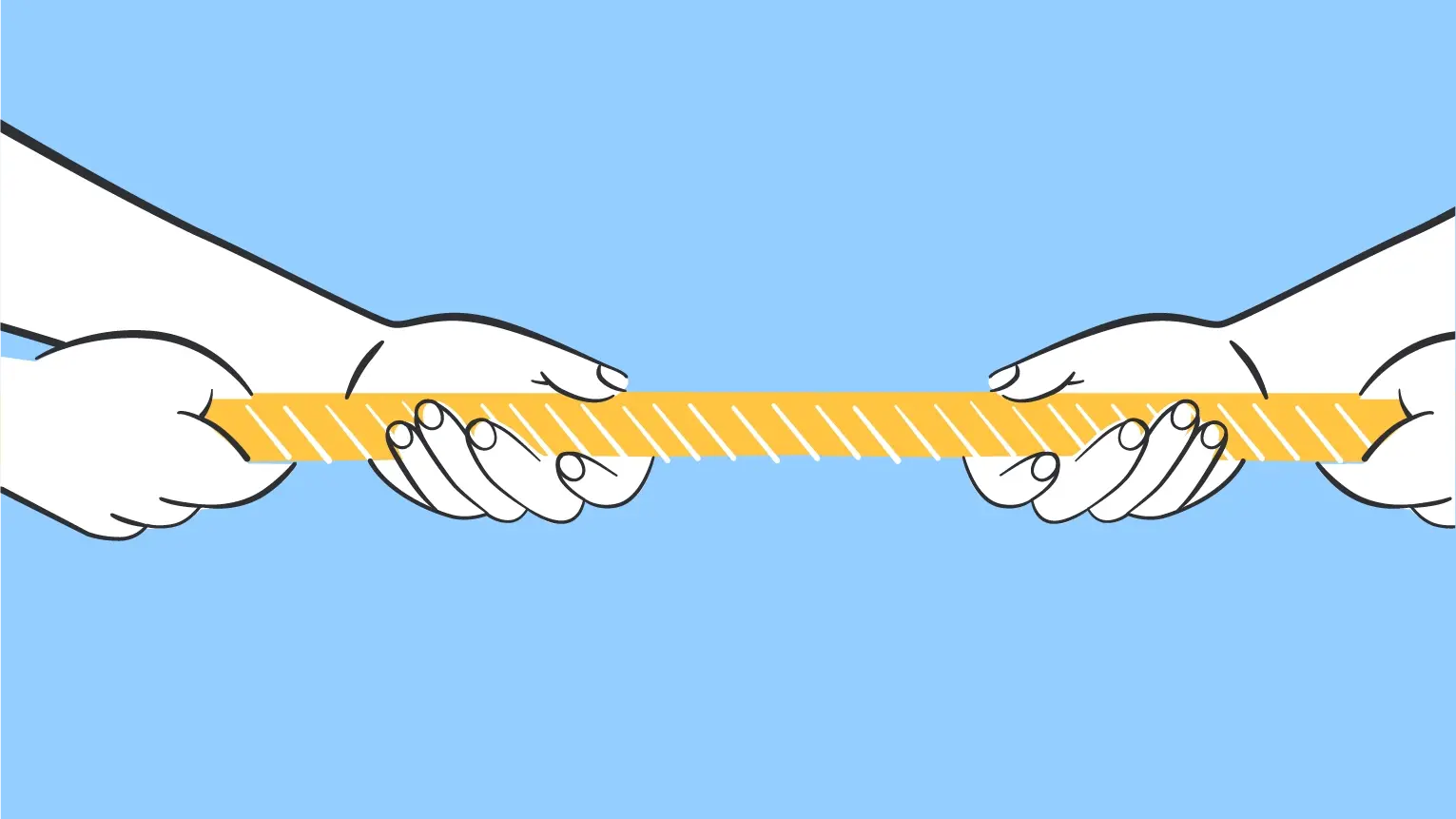
Braucht es eine europäische Armee? "Ja", sagt Gastkommentator Christian Kerl. Besser wäre es, die europäische Stimme in der Nato zu stärken, sagt Ulrike Winkelmann.

Der britische Publizist Oliver Moody zeigt, wie der Ostsee-Raum zu einer Konfliktzone wurde. Vor allem die Balten fürchten einen Angriff Russlands.