
Wie das Sondervermögen in die Schulen kommt : "Wir brauchen neue Lernorte und nicht nur neue Klos"
Klare Qualitätskriterien für Investitionen in Bildung und eine zukunftsfähige Schule fordert Barbara Pampe, Vorständin der Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft.
Frau Pampe, im Mai bezifferte das KfW-Kommunalpanel den Investitionsstau für Schulgebäude auf knapp 67 Milliarden Euro. Dieser Bereich liegt damit noch vor dem Investitionsstau im Verkehrsbereich. Wieso ist es derart dramatisch?
Barbara Pampe: Da kommen viele Sachen zusammen: Erstens der Sanierungs- und Instandhaltungsstau, weshalb die Schulgebäude oft in einem schlechten Zustand sind. Zweitens gibt es vor allem in großen Städten einen deutlich gestiegenen Bedarf an Schulplätzen; diese Kommunen kommen mit der Schaffung neuer Schulplätze nicht hinterher. Das heißt, zusätzlich zu den baufälligen Gebäuden brauchen wir dort auch noch neue Schulgebäude. Drittens stellen auch bildungspolitisch gesetzte Ziele und Entwicklungen wie Ganztag, Inklusion und Digitalisierung zusätzliche Anforderungen an Schulen.
In der Öffentlichkeit landen meist die krassesten Fälle von baufälligen Schulgebäuden, in denen es durchregnet. Ist das eine verkürzte Wahrnehmung des Problems?
Barbara Pampe: Es ist verkürzt, aber es ist leider eine Tatsache. Andererseits brauchen wir grundsätzlich andere Lernräume. Schule hat die Aufgabe, Schüler auf die Anforderungen des 21. Jahrhunderts vorzubereiten. Der typische Klassenraum ist vielleicht geeignet für den Frontalunterricht und reine Wissensvermittlung. Aber für das Erlernen anderer, zunehmend wichtiger Kompetenzen wie Kreativität, Kollaboration, kritisches Denken, demokratisches Zusammenleben oder den Umgang mit Informationen und deren Zusammenführung ist er schwierig. Für die dafür benötigten Lehr- und Lernsettings braucht es einen Mix verschiedener räumlicher Angebote unter anderem für Einzelarbeit, Rückzug und Ruhephasen, Präsentationen von Arbeiten, Bewegung, Essen, Theaterspielen.

Im Alltag mit Schulkindern erlebt man aber eher: Es geht oft nur um eine Rettung des Status quo.
Barbara Pampe: Ja. Auf der anderen Seite gibt es aber einen Paradigmenwechsel in der Pädagogik. Der ist natürlich für alle herausfordernd, für die Lehrkräfte und für die Schulträger, die Jahrzehnte immer auf der Basis fester Raumprogramme geplant haben. An diese ist lange nie jemand rangegangen und hat gesagt: Das passt überhaupt nicht mehr. Hier hat sich in den vergangenen Jahren viel verändert. Aber es braucht Prozesse, um neue Raumprogramme und Standards zu entwickeln und die sind oft langwierig. Deswegen kommt es eben noch oft zum Bauen nach alten Konzepten, in Bauten, die schnell hochgezogen werden können, auch aus Kosten- und Zeitgründen.
Schnelligkeit versus Nachhaltigkeit also?
Barbara Pampe: Leider ja. Und die politischen Rahmenbedingungen erleichtern eine Trendwende nicht unbedingt. Politiker sollen innerhalb einer Wahlperiode Lösungen für Probleme finden und dann zaubert man eben die Dinge aus der Schublade, die man schon hat und landet wieder bei den typischen Klassenraum-Flur-Schulen.
Sind diese Zeitspannen das einzige Problem?
Barbara Pampe: Nein. Es geht auch um die Zuständigkeiten im Schulbau. Auf nationaler Ebene gibt es niemanden, der sich dafür verantwortlich fühlt, weil Bildung Ländersache ist und der Schulbau in kommunaler Hand. Zwischen diesen Ebenen gibt es aber keinen fest institutionalisierten Austausch. Bei anderen Bauarten ist es völlig normal, zukünftige Nutzung und Architektur zusammenzudenken und zu planen, um am Ende die passenden Räume zu haben. Hier setzen wir als Stiftung an, indem wir die unterschiedlichen Akteure an einen Tisch bringen und anregen, die Dinge zusammendenken.
„Wir brauchen vereinfachte Verfahren, die trotzdem eine bestimmte Qualität sicherstellen.“
Wie sieht die ideale Schule aus?
Barbara Pampe: Sie bietet Räumlichkeiten für all die unterschiedlichen Aktivitäten des Schulalltags. Die Räume müssen variabel und wertschätzend gestaltet sein. Eigentlich bräuchten wir die schönsten Häuser für Schulen, denn wir verbringen dort viel Lebenszeit. Die Wirkung von Räumen und deren Gestaltung auf das Wohlbefinden und damit auch auf das Lehren und Lernen wird häufig unterschätzt.
Hören Sie oft den Einwand, innovative Baukonzepte seien zu teuer?
Barbara Pampe: Diese Sorge gibt es, aber tatsächlich ist es nicht so. Schulen werden zum Beispiel oft mit einer komplizierten, und somit teuren Technik ausgestattet. Wir haben deshalb Lösungen entwickelt, wie man von der hohen wartungs- und kostenintensiven Technik wegkommt. Dadurch wird es kostengünstiger und ist auch besser kompatibel mit dem Nutzerverhalten. Man braucht auch nicht mehr Flächen, wenn Räume für unterschiedliche Nutzungen den ganzen Tag von allen bespielt werden können.
Innovative Ideen sind das eine und eine oft schwerfällige Behördenstruktur das andere. Welche Erfahrungen machen Sie bei der Umsetzung von Projekten?
Barbara Pampe: Wir machen Pilotprojekte mit den Kommunen, um zu zeigen, dass es auch innerhalb der normalen Prozesse und Strukturen möglich ist, innovative Projekte umzusetzen. Natürlich verlangsamen gewisse Strukturen die Prozesse; wir brauchen vereinfachte Verfahren, die trotzdem eine bestimmte Qualität sicherstellen. Es geht darum, clever zu überlegen, wie uns die Innovation innerhalb des Rechtsrahmen gelingen kann.
„Der Moment, Schule zukunftsfähig zu gestalten, ist jetzt.“
Wie funktioniert das in der Praxis?
Barbara Pampe: Meistens schreiben wir unsere Pilotprojekte aus, für die sich Kommunen bewerben. Der Vorteil dabei ist, man findet so Kommunen, die Lust auf Veränderung haben. Schulträger, Gebäudemanagement und die Schule bewerben sich gemeinsam und wollen es gemeinschaftlich anpacken - eine Grundvoraussetzung. Große Städte wie Leipzig sind genauso dabei wie kleine Kommunen. Wir hatten zum Beispiel gerade ein Projekt in Jork, einer kleinen, engagierten Kommune in Niedersachsen, in dem es um das Thema Ganztag ging. Dort war die Frage: Wie können Bestandsgebäude minimalinvasiv so umgebaut werden, dass sie dem Rechtsanspruch auf ganztägige Förderung ab 2026 qualitativ und quantitativ gerecht werden.
6,5 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen fließen in den Bildungsbereich, 400 Millionen davon jährlich in Investitionsprogramme. Kann damit ein Neustart gelingen?
Barbara Pampe: Die Frage, ob diese Summe reicht, ist die eine Seite. Wichtig ist vor allem, dass die Gelder nachhaltig investiert werden. Es darf jetzt nicht nur um eine Pinselsanierung und das Reparieren von Dächern gehen. Das ist natürlich nötig. Aber wir müssen die Investitionen nutzen, um die Schulen auf ein Lernen im 21. Jahrhundert vorzubereiten. Es muss darum gehen, jetzt klare Qualitätskriterien zu entwickeln. Jede Investition in Schulgebäude muss als Investition für eine zeitgemäße und zukunftsgerichtete Pädagogik verwendet werden. Dazu müssen pädagogisch-räumliche Konzepte vorliegen, bevor Fördermittel ausgegeben werden, Planungs- und Bauprozesse müssen transparenter und effizienter werden. Das ist gerade jetzt wichtig, wo es mit dem Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung, dem Startchancen-Programm und dem Sondervermögen einen verbindlichen Anlass für Veränderung gibt. Der Moment, Schule zukunftsfähig zu gestalten, ist jetzt.
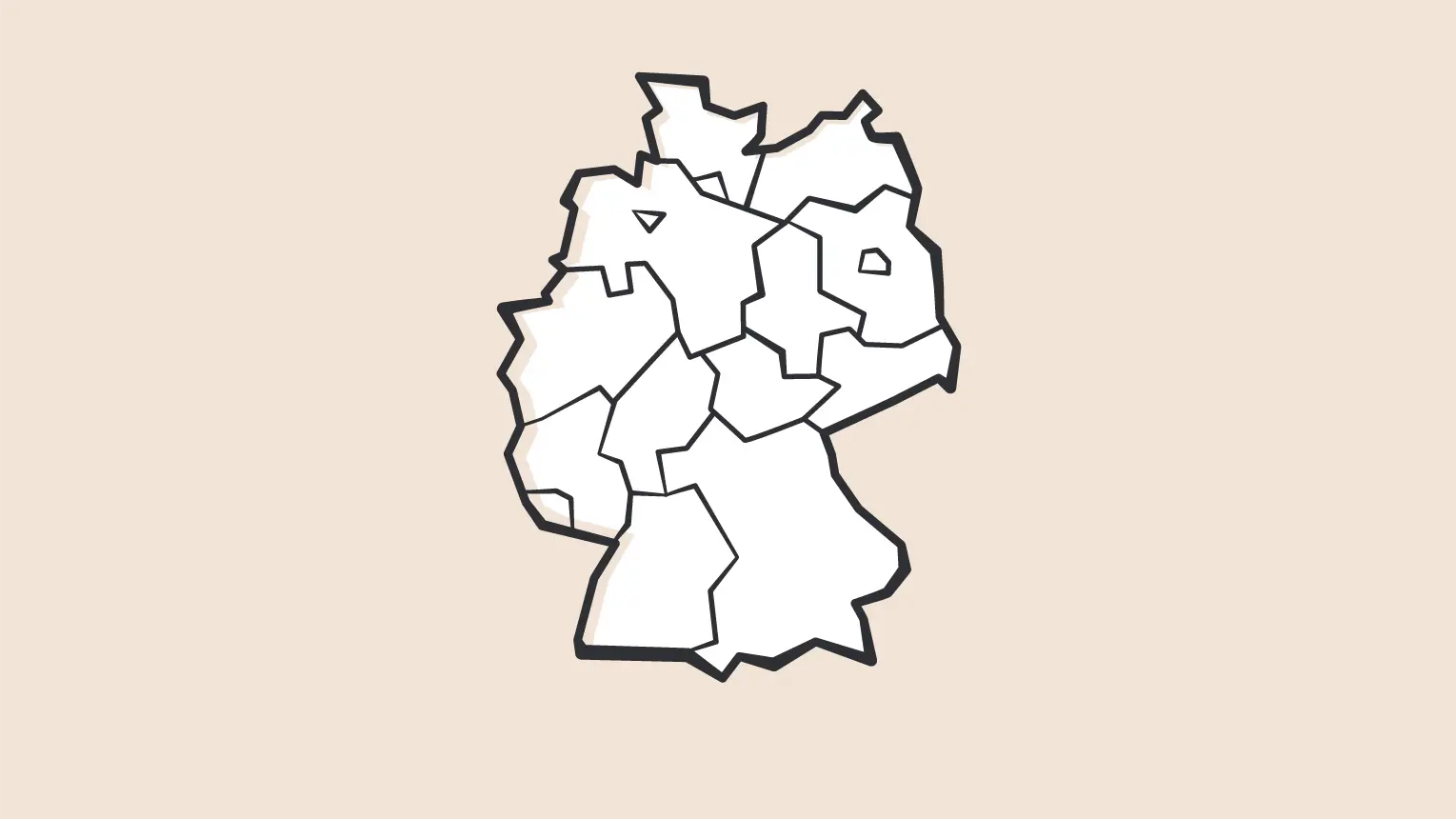
6,5 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen sind bisher für den Bildungsbereich eingeplant. Verbände, aber auch Wirtschaftsinstitute fordern deutlich mehr.

Wenn Basiswissen über Demokratie fehlt, haben Fake News umso bessere Chancen, sagt Forscherin Nina Kolleck und fordert eine entschlossene Strategie für die Schulen.

Noten und Lehrbücher gehören nicht zum Konzept der Universitätsschule. Stattdessen: fachübergreifende Projekte und individuelles Lernen. Kann das funktionieren?