Sönke Neitzel im Interview : "Die Bundeswehr hat der Demokratie loyal gedient"
Militärhistoriker Sönke Neitzel über die Bundeswehr, ihr Selbstverständnis und ihre Traditionen sowie den Wunsch nach militärischen Vorbildern in den Kampftruppen.
Bei Gründung der Bundeswehr 1955 sollte keine "neue Wehrmacht" entstehen, sondern in der Demokratie verankerte Streitkräfte. Ausdruck dieses Anspruchs war das Konzept der Inneren Führung und das Leitbild vom "Staatsbürger in Uniform". Ist die Bundeswehr diesem Anspruch vollumfänglich gerecht worden?
Sönke Neitzel: Diesem Anspruch ist sie absolut gerecht geworden. Die Bundeswehr sollte im Gegensatz zur Reichswehr in der Weimarer Republik eine Armee der Republik werden und nicht nur eine Armee in der Republik. Sicherlich war dieser Weg steinig, und ein Idealzustand lässt sich wahrscheinlich nie erreichen. Nicht jeder Soldat der Bundeswehr ist vom Verfassungspatriotismus durchdrungen, und es finden sich auch immer wieder Extremisten in ihren Reihen. Aber die Bundeswehr war in ihrer Geschichte nie eine Gefahr für die Demokratie und hat ihr loyal gedient.

Trotz der bewussten Abgrenzung zu Reichswehr und Wehrmacht gab es aber personelle Kontinuitäten...
Sönke Neitzel: Ja, rund 40.000 Soldaten der Wehrmacht und 500 der Waffen-SS wurden in die Bundeswehr übernommen.
Wie stark haben diese personellen Kontinuitäten denn die Bundeswehr in ihrer inneren Verfasstheit geprägt? Oder überspitzt formuliert: Wie viel Wehrmacht steckte dann doch in den neuen Streitkräften?
Sönke Neitzel: Die Bundesrepublik Deutschland hat sich im Gegensatz zur DDR für eine Elitenkontinuität entschieden. Allein 44 Generale der Wehrmacht haben die Bundeswehr mit aufgebaut. Der erste Generalinspekteur, Adolf Heusinger, hatte sogar noch in der kaiserlichen Armee gedient. Natürlich gab es im Bereich des militärischen Handwerks einen starken Bezug zu den Vorgängerarmeen, und die Offiziere und Unteroffiziere waren durch ihre militärischen Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg geprägt. Dies mischt sich in der Bundeswehr aber mit den Einflüssen der alliierten Partner. Sie bekommt zunächst amerikanische Ausrüstung, hat amerikanische, britische und französische Ausbilder, die ihre Vorstellungen und militärische Kultur einbringen. Die jüngeren deutschen Offiziere wiederum entwickeln ihre eigenen Ideen. Durch all diese Einflüsse entwickelt die Bundeswehr ihren ganz eigenen Fußabdruck. Sie unterscheidet sich da nicht von der Nachkriegsgesellschaft insgesamt. Rund neun Millionen ehemalige Wehrmachtssoldaten lebten in der Bonner Republik. Noch 1969 hatten zwei Drittel der Bundestagsabgeordneten eine Wehrmachtsvergangenheit. Auf der anderen Seite hat die Bundeswehr aber schon sehr früh den militärischen Widerstand gegen die Nationalsozialisten und das Attentat vom 20. Juli 1944 auf Hitler als wichtigen Referenzpunkt in ihr Traditionsverständnis aufgenommen, und dies hat sich auch gegen Widerstände durchgesetzt.
„Man kann eine kampfbereite Bundeswehr mit geplant 260.000 Soldaten nicht wie das Kaninchen aus dem Zylinder zaubern.“
Gab es auf Seiten der Nato-Verbündeten Vorbehalte, dass sie nun mit den ehemaligen Feinden zusammenarbeiten sollten?
Sönke Neitzel: Das war unterschiedlich. In Frankreich gab es in den 1950er-Jahren durchaus Vorbehalte und Zögerlichkeit bei der Zusammenarbeit mit deutschen Offizieren. Aber insgesamt spielte das erstaunlicherweise keine große Rolle. In den westlichen Armeen gab es eher eine Art von Soldatensolidarität mit den Deutschen. Es gab auch durchaus Bewunderung für die militärische Effizienz der Wehrmacht. Mitunter war die sogar überzogen, weil man den eigenen Sieg über die Wehrmacht noch größer erscheinen lassen wollte. Vor allem die amerikanischen Militärs sind an den Verbrechen der Wehrmacht kaum interessiert, denken in einer rein militärischen Logik. Für sie geht es in erster Linie darum, einen neuen Verbündeten gegen die Sowjetunion zu finden. Ein britischer Militärattaché beispielsweise hatte gar kein Verständnis für die Reformen im neuen deutschen Militär, bezeichnet die Institution des Wehrbeauftragten als "crowning nonsense", als völligen Unsinn. Die Deutschen sollen in erster Linie kämpfen können.
Sie haben das Traditionsverständnis der Bundeswehr angesprochen. Warum spielen Traditionen im Militär überhaupt eine so große Rolle?
Sönke Neitzel: Alle Streitkräfte weltweit haben ihre eigenen Traditionen und pflegen diese. Es ist schon auch eine wichtige gesellschaftliche Frage, welche Identität Soldaten haben. Was in der deutschen Zivilgesellschaft oft ausgeblendet wird, ist der Zweck von Streitkräften - nämlich die Androhung und notfalls auch Anwendung von militärischer Gewalt. Die Bundeswehr ist kein bewaffnetes Technisches Hilfswerk - auch wenn sie dies in den vergangenen 30 Jahren in verschiedenen Auslandseinsätzen oft zu sein schien. Wenn Soldaten in einen Kampfeinsatz geschickt werden, dann rücken Verfassungspatriotismus und Demokratie in den Hintergrund. Die Soldaten schauen nach Vorbildern, die militärische Leistungen vollbracht haben. Vor allem suchen sie diese Vorbilder auf der gleichen Ebene: Ein Zugführer der Panzertruppe sucht sich als Vorbild einen Panzersoldaten, der etwas als Panzersoldat geleistet hat und nicht beim Elbehochwasser. Vor allem in den Kampftruppen wünschen sich viele Soldaten der Bundeswehr artgerechte Vorbilder. Das ist im zivilen Bereich nicht anders. Wir alle haben Vorbilder, denen wir nacheifern. Beim Militär sind das eben oft die Soldaten vergangener Kriege.
Das aber wird in Deutschland nicht so gerne gesehen.
Sönke Neitzel: Ja, da haben wir ein Problem. In allen anderen Ländern wird das militärische Handwerk von der Politik getrennt. In Frankreich käme niemand auf den Gedanken, die militärische Tradition an die Verfassung der Fünften Republik zu knüpfen - dann blieben ja die militärischen Erfolge Napoleons unberücksichtigt. In Deutschland hingegen sagen wir, nur militärische Traditionen, die im Einklang mit dem Grundgesetz stehen, sind zulässig. Damit grenzt man die Tradition weitestgehend auf die Geschichte der Bundeswehr ein. Die Bundeswehr hat aber mit wenigen Ausnahmen - etwa in Afghanistan - nur selten gekämpft. Faktisch spielt militärische Tapferkeit in der offiziellen Tradition so gut wie keine Rolle. Und dies, obwohl die Soldaten der Bundeswehr das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes "tapfer verteidigen" sollen, wie es in der Eides- und Gelöbnisformel heißt.
„Eine Armee, die nicht kriegstüchtig ist, sollte man auflösen, denn sie verfehlt ihren Zweck.“
Das sehen Sie als Problem an?
Sönke Neitzel: Untergehen wird die Bundeswehr deshalb nicht. Aber in den Kampftruppen der Bundeswehr wird dies durchaus als Leerstelle empfunden. Und die einzige Partei, die das aktuell offen thematisiert, ist ausgerechnet die rechtsradikale AfD. Da ist mir nicht wohl. Im vergangenen Jahr gab es aus dem Verteidigungsministerium zwar Ergänzungen zum Traditionserlass von 2018, in denen auf die militärischen Leistungen im Ersten und Zweiten Weltkrieg jener Soldaten hingewiesen wurde, die maßgeblich am Aufbau der Bundeswehr und nicht an Kriegsverbrechen beteiligt waren. Aber nach wenigen Wochen hat das Ministerium dieses Papier wieder einkassiert aus Angst vor falschen Interpretationen. Wir müssen uns schon die Frage stellen, was Traditionsverständnis unter den Vorzeichen der Zeitenwende bedeutet und welche Vorbilder Soldaten brauchen, wenn sie notfalls kämpfen sollen.
Nun hat Verteidigungsminister Boris Pistorius davon gesprochen, die Bundeswehr müsse wieder "kriegstüchtig" werden. Ist das die richtige Wortwahl?
Sönke Neitzel: Ich finde das die richtige Wortwahl. Eine Armee, die nicht kriegstüchtig ist, sollte man auflösen, denn sie verfehlt ihren Zweck. In Deutschland wird der Begriff Krieg oft mit Angriffskrieg gleichgesetzt. Doch daran denkt in der Bundeswehr nun wirklich niemand. Natürlich reden wir über Verteidigung, aber auch ein Verteidigungskrieg ist ein Krieg.
Damit ist die Bundeswehr nach den drei Jahrzehnten der Auslandseinsätze wieder bei ihrem Gründungszweck angekommen. Kann sie denn aus ihrer eigenen Geschichte - damals bekam sie wegen des schnellen Aufbautempos ja auch durchaus Probleme - für die aktuelle Situation lernen?
Sönke Neitzel: Wir können sicherlich daraus lernen, dass es sich um einen längerfristigen Prozess handeln wird: Man kann eine kampfbereite Bundeswehr mit geplant 260.000 Soldaten nicht wie das Kaninchen aus dem Zylinder zaubern. Aber weil man das nicht kann, muss jetzt Tempo gemacht werden, denn es wurde schon zu viel Zeit verloren. Die Bundeswehr der Aufbaujahre war viel weniger von Bürokratie geprägt, war schlanker. Heute ist die Hälfte der Truppe in der Bürokratie eingesetzt und hat nichts mit ihrem unmittelbaren Auftrag zu tun. Auch das ist ein Ergebnis von sieben Jahrzehnten Friedensarmee. Die aktuelle Situation ist deutlich schwieriger, weil bestehende Strukturen reformiert werden müssen.
Hat die Politik die richtigen Schlüsse daraus gezogen?
Sönke Neitzel: Ich befürchte, dass der aktuellen Politikergeneration, die ja durchweg im Frieden aufgewachsen ist, der Ernst der Lage noch nicht klar ist. Die Gefahr eines Krieges wird von den meisten nicht als wirklich real angesehen. Das war in den 1950er Jahren anders. Es wird viel über die Zeitenwende geredet, und es sind auch Fortschritte erzielt worden. Aber beim Umbau der Truppe wurde bislang deutlich zu wenig Tempo gemacht. Da braucht es Beschleunigung. Jeder Reformschritt, den wir jetzt nicht gehen, wird im schlimmsten Fall mit dem Blut der Soldaten bezahlt. Das muss man der Regierung und den Abgeordneten des Bundestages, die ja die Verantwortung für die Parlamentsarmee tragen, sehr deutlich sagen.
Mehr zur Bundeswehr lesen
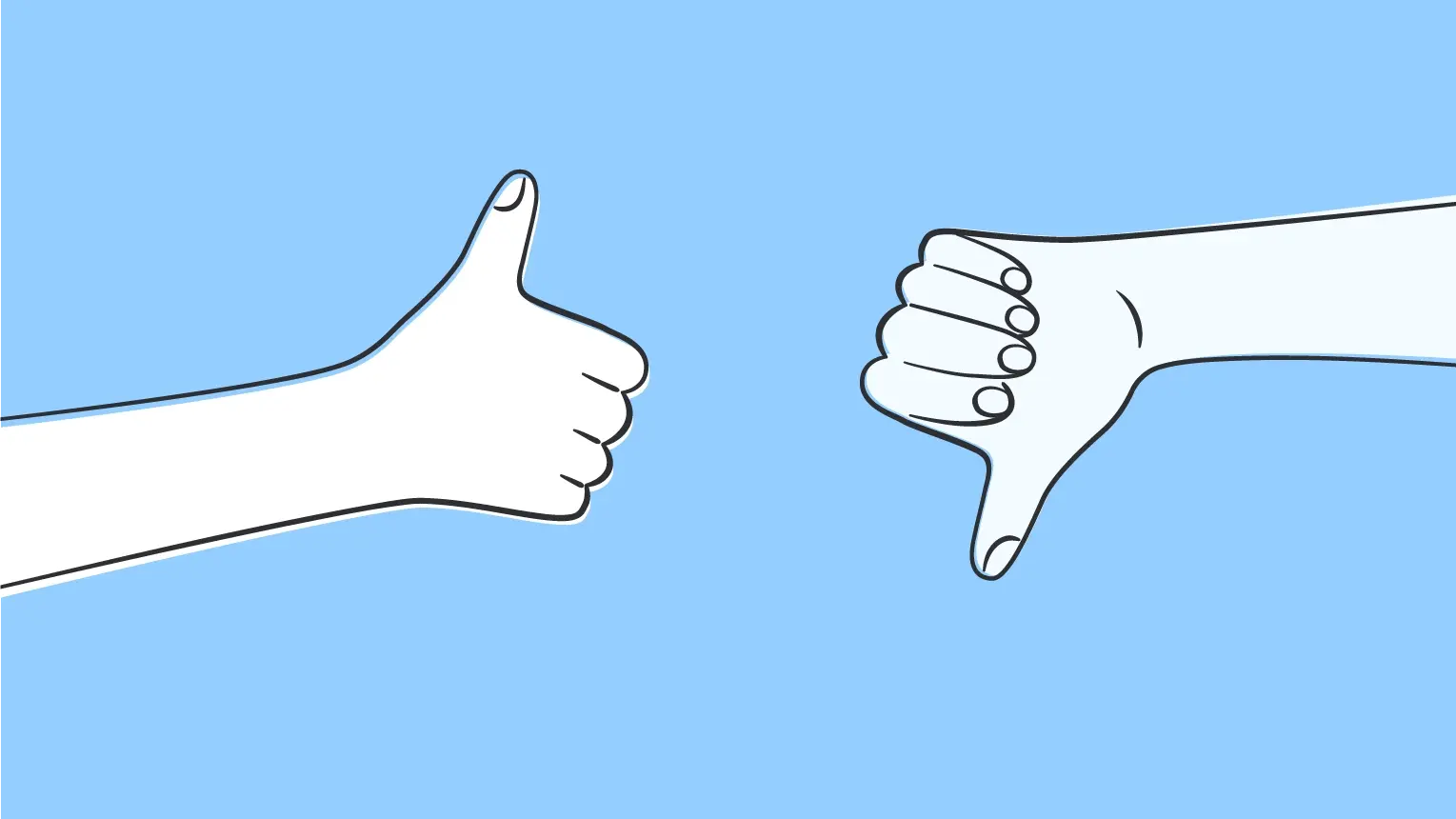
Ist die Debatte um die deutsche Verteidigungspolitik nach Pistorius' Ruf nach "Kriegstüchtigkeit" von übertriebener Kriegsrhetorik beherrscht? Ein Pro und Contra.

Die Rechtswissenschaftlerin Kathrin Groh erklärt, welche Pflichten möglich wären – und was das Grundgesetz zu einer allgemeinen Dienstpflicht sagt.

Erfahrungen zwischen Drill, Verantwortung und Wandel: Fünf Bundestagsabgeordnete berichten über ihre Zeit bei Bundeswehr, NVA und im Zivildienst.