Anhörung im Energieausschuss : An der CCS-Technologie scheiden sich die Geister
Ob bei Gaskraftwerken künftig auf das Abscheiden und Speichern von CO2 gesetzt werden soll, ist unter Experten umstritten. Manche sehen eine falsche Weichenstellung.

Ein Gaskraftwerk bei Irsching: Der Umgang mit dem bei solchen Kraftwerken anfallenden CO2 wird aktuell intensiv diskutiert.
Die Bundesregierung will die sogenannte CCS-Technologie zur Abscheidung und Einlagerung von CO2 auch in Gaskraftwerken einsetzen. Um das zu erreichen, hat das Kabinett im August die Änderung des Kohlendioxid-Speicherungsgesetzes gebilligt. Die Kritik an dem Vorhaben hält an. Anfang der Woche hat sich während einer öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Wirtschaft und Energie die Mehrheit der Sachverständigen gegen die CO2-Speicherung für Gaskraftwerke ausgesprochen.
Konkret sieht der Gesetzentwurf auch die Abscheidung, den Transport und die dauerhafte Speicherung von CO2 im Untergrund vor.
Umweltverbände laufen Sturm gegen CCS-Gesetz
Vor allem die Vertreter von Umweltverbänden warnten vor einer zu positiven Sicht auf die CCS-Technologie. Jörg-Andreas Krüger, Präsident des Naturschutzbunds Deutschland (Nabu), sieht mit Sorge, dass der Gesetzentwurf CCS-Technologie für alle Branchen prinzipiell öffnet. Der Einsatz von CCS müsse strikt auf unvermeidbare Restemissionen in ausgewählten Industrieprozessen wie Kalk und Zement beschränkt bleiben.
Kerstin Meyer, Leiterin Wirtschaft und Finanzen beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), sprach sich grundsätzlich gegen die Nutzung der CCS-Technik aus. "Das Gesetz stellt die Weichen gravierend falsch", sagte Meyer. Trotz massiver öffentlicher Subventionen seien die meisten CCS-Projekte, die es weltweit gegeben habe, gescheitert. Für die meisten Industrieanwendungen, die hierzulande diskutiert würden, läge die Ausfallrate ebenfalls bei hundert Prozent.
„Die Anwendung von CCS im deutschen Stromsektor ist nicht empfehlenswert.“
Auch Professor Wolfgang Köck vom Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) kritisierte den "sehr breiten Einsatz von CCS", den der Gesetzentwurf ermögliche. Die breite Nutzung von CCS trage dazu bei, dass Abhängigkeiten von fossilen Technologien verfestigt würden. Der notwendige Umbau von Energiewirtschaft und Industrie werde dadurch verzögert oder blockiert.
Befürworter sehen in dem geplanten Gesetz “das richtige Signal”
"Die Anwendung von CCS im deutschen Stromsektor ist nicht empfehlenswert", erklärte Fabian Liss, Referent für Industrielles Carbon-Management bei der Bellona Deutschland. Anstatt über CCS als Möglichkeit der partiellen Dekarbonisierung von stromgeführten Gaskraftwerken zu diskutieren, solle die Sicherung von Kapazitäten für die Versorgungssicherheit priorisiert werden.
Befürworter wie Matthias Belitz, Bereichsleiter für Nachhaltigkeit, Energie und Klimaschutz beim Verband der Chemischen Industrie (VCI), sehen das komplett anders. Er nannte das von der Bundesregierung geplante Gesetz "das richtige Signal", das schnell umgesetzt werden solle. Aus seiner Sicht sollten mit Erdgas betriebene Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen von der CCS-Förderung über Klimaschutzverträge oder über die Bundesförderung Klimaschutz und Industrie eingebunden werden.
Unternehmer plädieren für schnelle Umsetzung
Auch André Brauner, Abteilungsleiter bei der Open Grid Europe, sprach sich für eine schnelle Umsetzung des Vorhabens aus. Der Entwurf sei ein "industriepolitisches Standortgesetz und ein Klimagesetz zugleich". Der Bundestag solle es nun zügig verabschieden.
Für Professor Sven-Joachim Otto, Rechtsanwalt und Mitglied des Direktoriums des Institutes für Berg- und Energierecht der Ruhr-Universität Bochum, stellt der Entwurf ebenfalls "einen wichtigen Schritt" dar. Mit den vorgeschlagenen "präzisen Ergänzungen" werde er zu einem "robusten, liberalen und technologieoffenen Fundament für die industrielle Dekarbonisierung, ohne das Schutzniveau zu relativieren", sagte Otto.
Zum Weiterlesen

Die Energiekosten sollen sinken. Dafür haben sich Union und SPD viel vorgenommen, etwa den Ausbau von Gaskraftwerken und Wasserstoffkapazitäten.
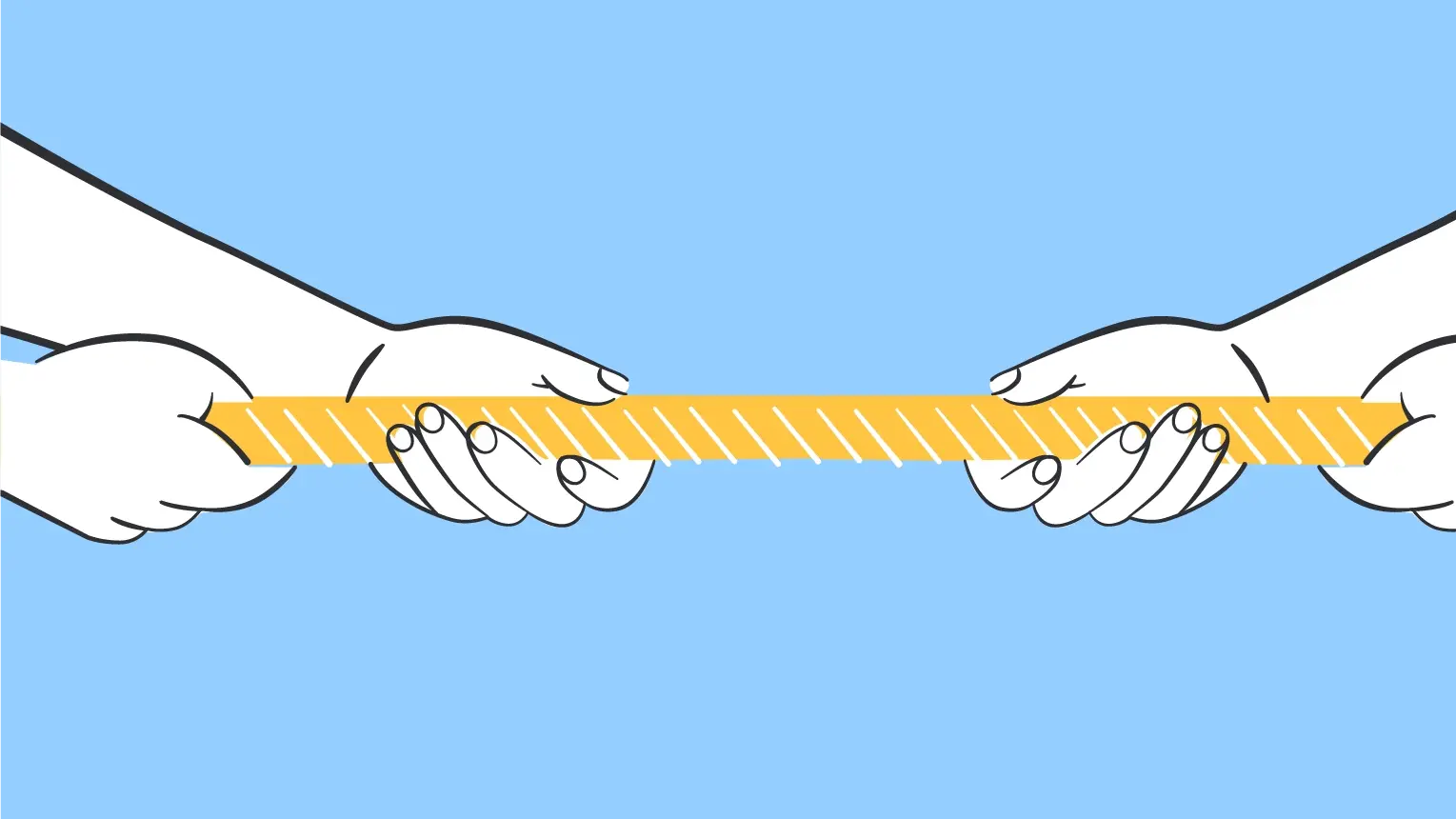
Ist die Regierung mit ihrem Kohlendioxid-Speicherungsgesetz auf dem richtigen Weg? Ja, meint Klaus Stratmann, nein, findet Ann-Kathrin Büüsker.

Bis 2045 will Deutschland klimaneutral sein. Wie die Zementindustrie auf dieses Ziel hinarbeitet, zeigt der Baustoffhersteller Holcim in Höver. Ein Werksbesuch.
