
Investitionen in die Energieinfrastruktur : "Wir erleben einen Realitätscheck"
Für bezahlbare Energie und eine wettbewerbsfähige Wirtschaft ist der gleichzeitige Ausbau der Energieinfrastruktur notwendig, sagt IW-Energieexperte Andreas Fischer.
Herr Fischer, Deutschland befindet sich inmitten einer Energiewende. Die Bundesregierung stellt nun ein Investitionsprogramm von 500 Milliarden Euro zur Verfügung, um damit die Infrastruktur zu modernisieren. Was gehört zum Neustart der Energiewende?
Andreas Fischer: Ich würde die Formulierung etwas anpassen. Es ist ein Neustart geplant. Aber die Frage ist, ob es wirklich einen Neustart bei der Energiewende braucht oder eher Kurskorrekturen, die teilweise in den vergangenen Jahren bereits angestoßen wurden.
Was würden Sie korrigieren?
Andreas Fischer: Beim Start des Ausbaus der Erneuerbaren ging es darum, überhaupt erst einmal auszubauen, und zwar so viel wie möglich. Jetzt sind wir an dem Punkt, an dem es darum geht, die Effizienz zu erhöhen und auch andere Infrastrukturen mitzudenken. Das heißt beispielsweise, wo und wann kann der erneuerbare Strom effizient eingespeist und genutzt werden. Dabei geht es unter anderem darum, gewisse Fördermechanismen anzupassen.

Was soll angepasst werden?
Andreas Fischer: Die Vorgängerregierung hat bereits einige Dinge angestoßen oder angepasst, die wichtig sind. Zu nennen sind da erste Überlegungen zu Abscheidung, Transport und Speicherung von Kohlenstoff, die Planung eines Wasserstoff-Kernnetzes und auch Anpassungen bei den erneuerbaren Energien, zum Beispiel durch eine bessere Regelbarkeit von neuen Photovoltaikanlagen (PV) und den Wegfall der Einspeisevergütung in Zeiten negativer Strompreise. Letzteres heißt, dass man mehr in Richtung eines netzdienlicheren Betriebs und an die effiziente Versorgung denkt und nicht nur an den reinen Ausbau. Ich gehe davon aus, dass manche dieser Pfade von der schwarz-roten Bundesregierung weitergeführt werden und wir keinen kompletten Neustart sehen werden.
Welche Investitionen in die Energieinfrastruktur halten Sie für vorrangig? Wirtschaftsministerin Katherina Reiche hat den Bau neuer Gaskraftwerke angekündigt.
Andreas Fischer: Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist auch nicht, ob, sondern wie viele Gaskraftwerke wir wo brauchen, um die Energieversorgung zu sichern. Aber gleichzeitig sollte der Netzausbau und der Ausbau von Batteriespeichern nicht hintangestellt werden. Und auch den Aufbau von Infrastrukturen für Wasser- und Kohlenstoff benötigen wir für die geplante Transformation. In diesen Bereichen ist in den vergangenen Jahren vieles angedacht und teilweise auch auf den Weg gebracht worden.
Zum Beispiel?
Andreas Fischer: Es reicht nicht, viel Geld für den Ausbau in die Kohlenstoffinfrastruktur vorzuschießen, entscheidend ist, dass die Politik erst einmal die Rahmenbedingungen dafür schafft. Momentan ist es so, dass Kohlenstoffabschreibung, Speicherung und Transport kommerziell überhaupt nicht erlaubt sind. Konkret bedeutet es, Rahmenbedingungen herzustellen, damit Investitionen im Bereich CO2-Abscheidungs- und Speicherungstechnologien (CCS) sowie Nutzungstechnologien (CCU) überhaupt erst einmal möglich werden.
„Wir sollten überlegen, ob wirklich jede Kilowattstunde gleich vergütet werden soll.“
Der Koalitionsvertrag kündigt ein Gesetzespaket an, mit dem der CCS/CCU-Einsatz für schwer vermeidbare Emissionen des Industriesektors und für Gaskraftwerke ermöglicht werden soll. Die Errichtung von CCS/CCU-Anlagen und -Leitungen soll zudem als im überragenden öffentlichen Interesse stehend eingestuft werden.
Andreas Fischer: Es muss noch beantwortet werden, bei welchen Anwendungen CCS sinnvoll bzw. notwendig ist oder ob es günstigere Alternativen gibt. Sicher ist aber bereits heute, dass wir in Bereichen wie der Zement- und Kalkindustrie CCS auf jeden Fall benötigen. Daher ist dieses Gesetz nötig. Die Vorgängerregierung hatte dazu bereits ein Gesetz vorgelegt, das noch zu Beginn dieses Jahres verabschiedet werden sollte. Wir haben Zeit verloren, weil sich die verschiedenen Fraktionen nicht einigen konnten, obwohl sie sich grundsätzlich in der Sache längst einig waren. Nun ist zu hoffen, dass das Gesetz zeitnah in den Bundestag eingebracht und zügig verabschiedet wird.
Sind die Ausbauziele für Windkraft, PV und der Netzausbau überdimensioniert? Wo sollten Prioritäten gesetzt, wo gespart werden?
Andreas Fischer: Wichtig ist es, die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass eine effizientere Einspeisung der Erneuerbaren möglich wird. Aber auch beim Aufbau der Stromversorgung gibt es Sparpotenziale, wie durch den Bau von Überlandleitungen statt Erdkabeln, die Überbauung von Netzschlusspunkten sowie die parallele Nutzung von Solar- und Windanlagen an einzelnen Anschlüssen und eine stärkere Ausrichtung des Windausbaus auf See nach dem eigentlichen Ertrag anstatt der zugebauten Nennleistung.
Die Branche der erneuerbaren Energien hat bislang wenige Anreize, die Stromproduktion nach Erfordernissen des Marktes zu gestalten. Welche gesetzlichen Vorgaben wären sinnvoll?
Andreas Fischer: Es sollte überlegt werden, ob wirklich jede Kilowattstunde gleich vergütet werden soll, oder ob es nicht besser wäre, die Vergütungssätze zu dynamisieren oder stattdessen Investitionszuschüsse zu gewähren. Dadurch sinkt der Anreiz, den Strom zu den Stunden ins Netz einzuspeisen, in denen es alle tun. Um eine wirklich netzdienliche Einspeisung anzureizen, braucht es regionale Preissignale. Das würde den Netzausbau und vor allen Dingen das Netzmanagement vereinfachen, mit dem Ergebnis, dass die Preise fallen würden.
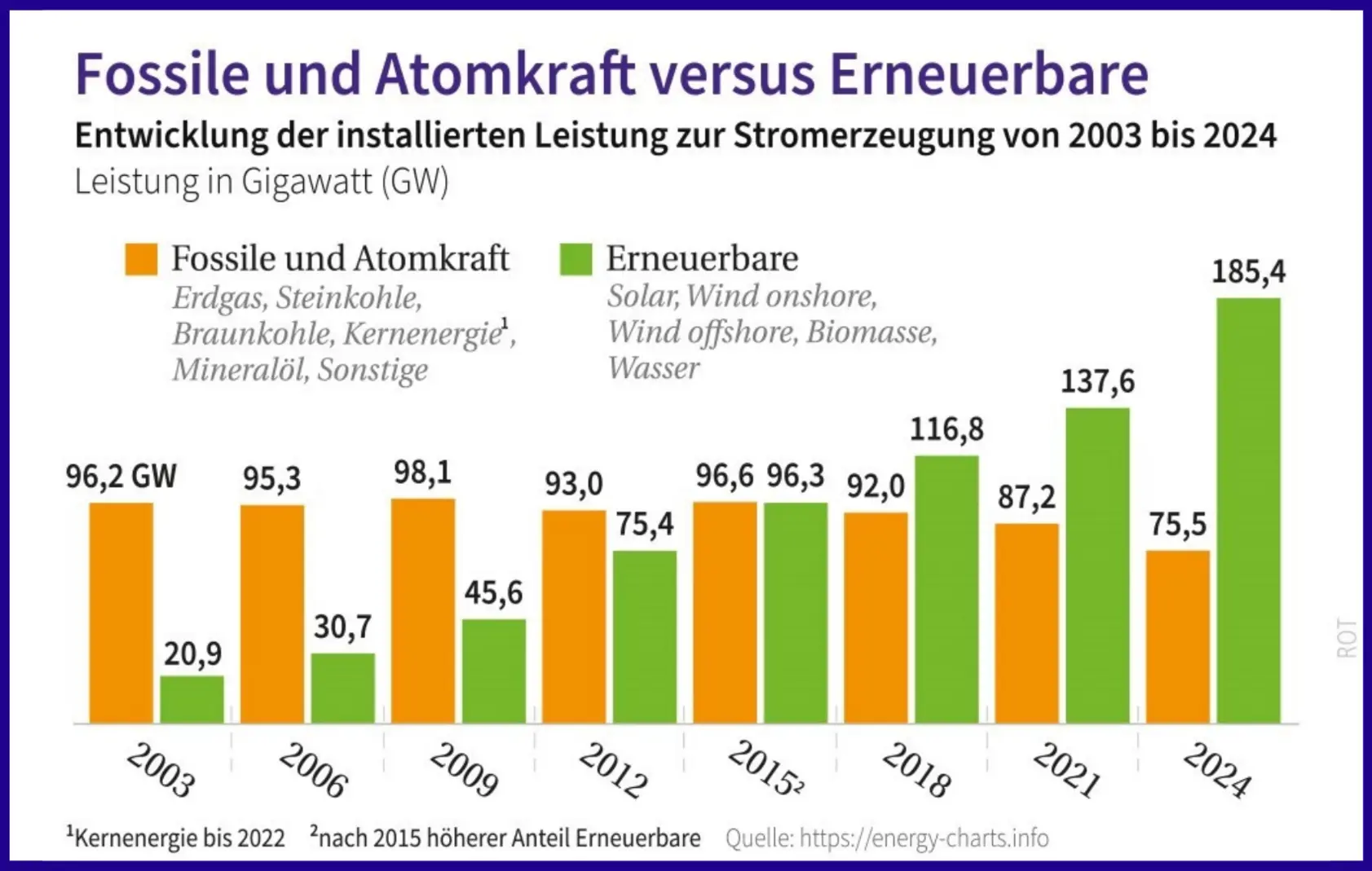
Ist es realistisch, die Erneuerbaren und das Netz synchron auszubauen?
Andreas Fischer: Grundsätzlich sollte das getan werden. Leider hat man bereits in den 2010er-Jahren ein gewisses Henne-Ei-Problem geschaffen: Die Erneuerbaren wurden ein bisschen gedrosselt, damit sie das Netz nicht überfordern. Aber der Netzausbau ging nicht schnell genug voran. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass sich beide Aspekte nicht erneut blockieren.
Ich nenne ein Beispiel aus Bayern mit Blick auf den starken Zubau der Solarenergie in den letzten Jahren: Dort ist die Menge des abgeregelten Solarstroms stark angestiegen, weil die Netzbetreiber das nicht anders handhaben konnten. Deshalb braucht es den Netzausbau und mehr Flexibilitätsoptionen, wenn die Erneuerbaren weiter ausgebaut werden. Das bedeutet, je mehr Leitungskapazität im Netz, flexible Verbraucher und Speicher zur Verfügung stehen, desto mehr Einspeisung der Erneuerbaren kann effizient eingebunden werden, vor allem wenn regionale dynamische Preissignale den netzdienlichen Betrieb anreizen.
Die Bundesregierung will bis zu 20 Gigawatt neue Gaskraftwerke bauen, eine verpflichtende Umstellung der Anlagen auf Wasserstoff soll unter Schwarz-Rot entfallen. Wie bewerten Sie die Pläne?
Andreas Fischer: Ich halte den Zubau neuer Kraftwerke für verständlich und sinnvoll. Wir benötigen verschiedene Technologien für unsere Energieversorgung. Steuerbare Kraftwerke sind notwendig, um in Zeiten geringer Einspeisung der Erneuerbaren, beispielsweise während Dunkelflauten, eine stabile Versorgung zu gewährleisten. Langfristig sollten die geplanten neuen Anlagen auf Wasserstoff umrüstbar sein, damit die Kraftwerke später klimaneutral arbeiten können. Dann wäre auch eine Kapazität von 20 Gigawatt gerechtfertigt.
Der Umstieg auf erneuerbare Energien belastet das Stromnetz. Um die dadurch entstehenden Schwankungen im Netz abzufangen, gelten Großbatteriespeicher als Lösung. Lassen sich mit diesen Speichern längere Dunkelflauten überbrücken?
Andreas Fischer: Auch bei der Frage Batteriespeicher oder regelbare Kraftwerke gibt es kein Entweder-oder, sondern ein Sowohl-als-auch. Batteriespeicher und Großspeicher sollen Ungleichheiten im Netz kurzzeitig ausgleichen. Gas- oder Wasserstoffkraftwerk sollen vor allem dann einspringen, wenn längere Zeitabstände überbrückt werden müssen. Wir können nicht davon ausgehen, dass wir den gesamten Energiebedarf in den nächsten Jahren nur mit mehr Batteriespeichern und den erneuerbaren Energien abdecken. Deshalb brauchen wir die Speicher zusammen mit den regelbaren Kraftwerken.
„2024 ist das Wasserstoff-Kernnetz genehmigt worden, das ist ein wichtiges Signal für den Aufbau einer Wasserstoff-Infrastruktur.“
Wo stehen wir beim Ausbau der Speicher?
Andreas Fischer: Der Ausbau geht voran. Bis Ende 2024 hatte Deutschland rund 19 Gigawattstunden am Netz, ein Jahr zuvor waren es erst knapp zwölf. Allerdings handelt es sich bei den Speichern meistens um kleine Heimspeicher, die an PV-Anlagen auf Einfamilienhäusern angeschlossen sind. Es braucht mehr Großspeicher im dreistelligen Megawattstundenbereich, beispielsweis 200 oder 600 MWh, und diese Projekte kommen gerade in Gang. Die Übertragungsnetzbetreiber arbeiten auch an sogenannten Netzboostern - einem Verbund aus Batteriemodulen -, um den Netzbetrieb zu stabilisieren.
Wasserstoff sollte fossile Energien ersetzen. Doch der Hype bekommt erste Dämpfer - mit dem Argument, eine baldige Nutzung sei unrealistisch. Wie sollte die Bundesregierung mit dem Thema Wasserstoffausbau umgehen?
Andreas Fischer: Was wir gerade erleben, ist kein kompletter Rückzug, sondern ein Realitätscheck. In gewissen Bereichen, wie der Stahl- oder der chemischen Industrie, ist Wasserstoff nötig, wenn Prozesse wirklich klimaneutral werden sollen. Deshalb ist es richtig, das weiter voranzutreiben. 2024 ist das Wasserstoff-Kernnetz genehmigt worden, das ist ein wichtiges Signal für den Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur.
Und mit welchem Wasserstoff soll das Netz betrieben werden?
Andreas Fischer: Langfristig mit grünem Wasserstoff, der durch Strom aus erneuerbaren Energien hergestellt wird. Mindestens bis dieser in ausreichendem Maße zur Verfügung steht, werden wir voraussichtlich auch blauen - mithilfe von Erdgas und Kohlenstoffabscheidung hergestellten - Wasserstoff verwenden.

Die Energiekosten sollen sinken. Dafür haben sich Union und SPD viel vorgenommen, etwa den Ausbau von Gaskraftwerken und Wasserstoffkapazitäten.

Die Union will Versorgungssicherheit, die Grünen warnen vor einem "Gas-Boom" und die AfD setzt auf Atomkraft. Über die künftige Energiepolitik wurde hart debattiert.

Damit die Europäische Union bis 2050 klimaneutral wird, setzen die Mitgliedstaaten unter anderem auf Batterien und Wasserstoff.