
Geringer Mittelabfluss, ineffiziente Nutzung : Klimafonds in der Kritik
Der Bundesrechnungshof hat das zentrale Finanzierungselement der Energiewende, den KTF, immer wieder gerügt. Im Bundestag fallen die Reaktionen unterschiedlich aus.
30 Sondervermögen gibt es aktuell auf Bundesebene. Die ältesten dieser Nebenhaushalte wurden bereits in den 1950er-Jahren geschaffen, wie etwa das ERP-Sondervermögen, das auf den Marshallplan der Nachkriegszeit zurückgeht. Die Einrichtung des jüngsten, das Sondervermögen "Infrastruktur und Klimaneutralität", beschloss der Bundestag im März. Doch kaum ein anderes Sondervermögen stand zuletzt so in der Kritik wie der Klima- und Transformationsfonds (KTF). Mehrfach rügte der Bundesrechnungshof in den letzten Jahren den "schleppenden Mittelabruf". Die Gelder würden nicht effizient genug eingesetzt; der Bundestag erhalte zu wenig Informationen zur Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Fördermaßnahmen, heißt es etwa 2024 in einem Bericht an den Haushaltsausschuss.
Bundesverfassungsgericht verwarf 2023 komplette Haushaltsplanung
Kein gutes Zeugnis, das die Behörde dem Fonds ausstellt, der oft als "Allzweckwaffe" der damaligen Ampelregierung für Klimaschutz und Energiewende bezeichnet wird: Mit 60 Milliarden Euro nicht benötigter Corona-Kredite hatte sie rückwirkend für das Haushaltsjahr 2021 den Fonds zusätzlich ausgestattet, um den Weg zur Klimaneutralität zu finanzieren.
Doch die Übertragung der Gelder erklärte das Bundesverfassungsgericht im November 2023 für unzulässig. Im KTF klaffte daraufhin ein Loch, Förderprogramme wurden zusammengestrichen, die Ampel erwog kurzzeitig sogar die Abwicklung des Fonds.

„Investitionen in Mikroelektronik entsprechen nicht Sinn und Zweck des KTF, das ist klassische Industrieförderung.“
Ein Schritt, den der Bundestagsabgeordnete Andreas Mattfeldt (CDU) befürwortet hätte. Der Haushaltspolitiker ist Hauptberichterstatter für den KTF, schon lange gehört er zu seinen schärfsten Kritikern. Sein Hauptargument: "Der Mittelabfluss war schon immer unterirdisch schlecht." Seit Jahren rechne die Bundesregierung mit mehr Ausgaben, als später gebraucht würden. "Seit Errichtung des KTF hat die Bundesregierung im Jahresdurchschnitt ein Drittel der Gelder nicht verausgabt", heißt es auch 2023 in einem Bundesrechnungshof-Bericht. 2022 seien sogar mehr als die Hälfte der Gelder übrig geblieben. 2023 habe sich der Abfluss verbessert, trotzdem seien nur etwa 60 Prozent der Mittel verwendet worden.
Kritiker fordern Auflösung, Befürworter wollen strengere Prüfungen
Die Grünen-Haushaltspolitikerin Katrin Uhlig verweist darauf, dass Förderprogramme auch während eines laufenden Haushaltsjahres neu aufgesetzt oder überarbeitet würden. Gerade wenn diese nicht "überjährig" seien, also nicht über ein Haushaltsjahr hinweg liefen, könne es beim Abruf zu Verzögerungen kommen, weil Anträge noch geprüft oder Unterlagen nachgefordert werden müssten. Es gebe vielfältige Ursachen, warum Gelder nur langsam abflössen, so Uhlig. “Förderlinien müssen daher regelmäßig überprüft und wenn nötig überarbeitet werden.”
Mattfeldt hingegen sieht in der Konstruktion als Sondervermögen das Hauptproblem: Verantwortlich für den Fonds sei zwar das Finanzministerium, doch sieben weitere Ministerien bewirtschaften dessen unterschiedliche Einzelposten. Anders als der Kernhaushalt stünde er nicht derart "im Blickpunkt" und werde "eher stiefmütterlich behandelt". Seine Forderung seit Jahren: Den KTF auflösen und die Mittel in die Einzelpläne der Ressorts überführen. "Das würde auch helfen, bestehende Doppelstrukturen abbauen", sagt Mattfeldt. Regelmäßig ähnelten KTF-Projekte solchen, die über den regulären Haushalt gefördert würden.
Der Klima- und Transformationsfonds im Überblick
⚡️ Mit dem 2010 als "Energie- und Klimafonds" eingerichtete Nebenhaushalt wollte Schwarz-Gelb die Energiewende finanzieren.
🚦 2022 in "Klima- und Transformationsfonds" umbenannt, machte die Ampel den KTF zum zentralen Instrument für die Transformation zur Klimaneutralität.
💶 Im Gegensatz zum Kernhaushalt speist sich der KTF nicht aus Steuergeld, sondern erhält Einnahmen aus dem Emissionshandel sowie dem CO2-Preis.
Doch der so oft kritisierte Fonds erlebt nun vorerst dank des Sondervermögens "Infrastruktur und Klimaneutralität" ein Comeback: 100 Milliarden erhält der KTF bis 2034 zusätzlich. Darauf hatten die Grünen im Gegenzug für ihre Zustimmung zu der dafür nötigen Lockerung der Schuldenbremse bestanden. Die Kritik an der mangelnden Effizienz der Fördermaßnahmen lässt Katrin Uhlig den KTF nicht grundsätzlich in Frage stellen: "Der Bundesrechnungshof legt sehr enge Kriterien an. Doch die Auswirkung auf Treibhausgasemissionen lässt sich nicht bei allen KTF-Projekten direkt messen." Bei Bildungsmaßnahmen, die Menschen etwa dabei unterstützten, effizienter mit Energie zu haushalten, sei die Wirkung eher mittelbar. "Aber das heißt nicht, dass sie keinen Beitrag zur Reduktion leisten."
Regierung und Opposition werfen sich Zweckentfremdung vor
Es müsse hinterfragt werden, was aus dem Fonds finanziert werde. Dass Union und SPD ihn nun nutzen wollten, um die Gasspeicherumlage abzuschaffen, widerspreche dessen gesetzlicher Grundlage, sagt sie. Danach sollen damit zusätzliche Maßnahmen finanziert werden, "die der Erreichung der Klimaschutzziele dienen". Eine andere Zweckentfremdung sieht dagegen Mattfeldt: "Investitionen in Mikroelektronik entsprechen nicht Sinn und Zweck des KTF, das ist klassische Industrieförderung." Lange habe die Ampel Kritik ignoriert. Mit dem Haushalt 2026 werde Schwarz-Rot den KTF "auf Spur" bringen.

Bis 2045 will Deutschland klimaneutral sein. Wie die Zementindustrie auf dieses Ziel hinarbeitet, zeigt der Baustoffhersteller Holcim in Höver. Ein Werksbesuch.
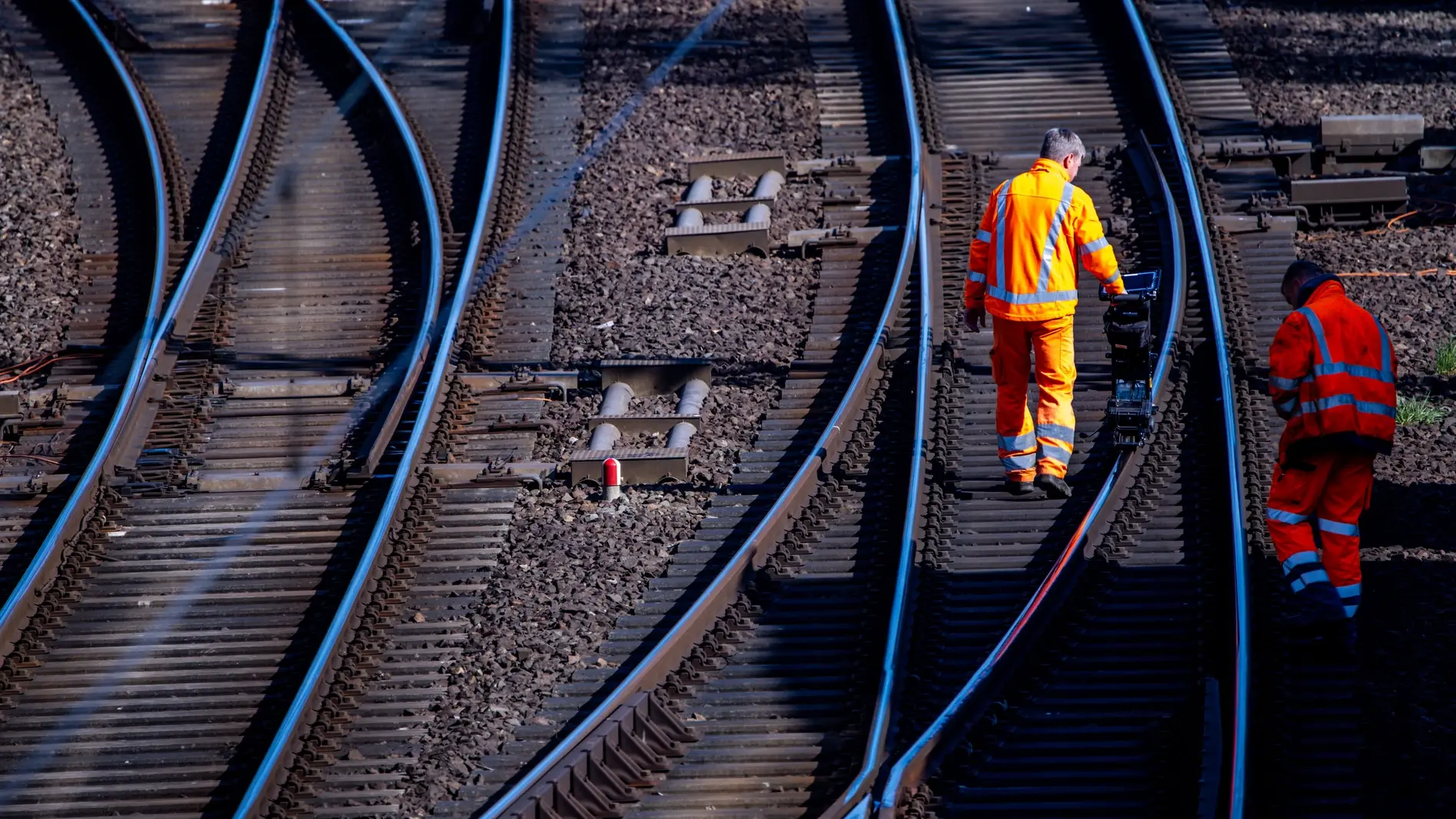
300 Milliarden Euro sollen aus dem neuen Sondervermögen in die Infrastruktur fließen. Knapp ein Drittel davon sind laut Plänen der Bundesregierung bereits verplant.

Für bezahlbare Energie und eine wettbewerbsfähige Wirtschaft ist der gleichzeitige Ausbau der Energieinfrastruktur notwendig, sagt IW-Energieexperte Andreas Fischer.