
Weltklimagipfel in Belém : Die wichtigsten Beschlüsse im Kampf gegen die Erderwärmung
Mehr Geld zum Schutz von Tropenwäldern, aber kein Plan für den Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas. Was auf der Klimakonferenz beschlossen wurde und was offen bleibt.
Inhalt
Fast zwei Wochen lang haben im brasilianischen Belém rund 40.000 Delegierte aus mehr als 190 Staaten um einen Kompromiss für mehr Klimaschutz gerungen. Was dabei herausgekommen ist, kritisieren Umweltorganisationen und Aktivisten als unzureichend und inakzeptabel. Auch Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) zeigte sich "ein bisschen enttäuscht" und warf den Ölstaaten eine Blockadetaktik vor. Er habe sich „deutlich mehr“ beim Ausstieg aus Verbrennungstechnologien gewünscht.
So endete die Konferenz ohne einen verbindlichen Plan zum Ausstieg aus fossilen Energien. Aber auch in anderen Punkten blieb das achtseitige Abschlussdokument weit hinter den Erwartungen zurück. Bei den Klimakonferenzen werden die Entscheidungen nach dem Konsensprinzip getroffen. Damit reicht das Veto eines Landes, um einen Beschluss zu verhindern.

Der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva reiste gleich zweimal persönlich nach Belém, um die Staaten zusammen zu weitreichenderen Beschlüssen zu bewegen.
Vage Zusagen für Klimafinanzierung in ärmeren Staaten
Verabredet wurde, dass reiche Staaten ihre Klimahilfen an ärmere Länder zur Anpassung an die Folgen der Erderhitzung deutlich erhöhen. Die Rede ist von einer Verdreifachung bis 2035. Doch wird im Abschlussdokument weder ein Basisjahr noch ein konkreter Betrag genannt. Erwartet wird, dass die Summe deutlich unter den jährlich 120 Milliarden US-Dollar liegen wird, die die Entwicklungsländer vehement gefordert hatten.
Dabei hatten sich die Staaten schon auf der Weltklimakonferenz 2024 in Baku auf ein neues Klimafinanzierungsziel geeinigt. Danach sollten die Industrieländer ihre Unterstützung für Entwicklungsländer bis 2035 auf mindestens 300 Milliarden US-Dollar jährlich steigern. Kurz vor Beginn der Konferenz in Belém wurden in der sogenannten Baku-to-Belém-Roadmap Möglichkeiten aufgezählt, wo das Geld herkommen könnte; die Vorschläge reichten von einer Reform der Entwicklungsbanken bis hin zu Anreizen, um mehr privates Kapital in Klimaprojekte zu lenken. Doch keiner dieser Umsetzungsschritte wurde beschlossen.
Bundesregierung sagt zusätzlich 60 Millionen Euro zu
Bundesumweltminister Carsten Schneider sagte in Belém allerdings zusätzliche 60 Millionen Euro von deutscher Seite für Klimahilfen zu. Die Zahlungen an den sogenannten Anpassungsfonds würden unter anderem genutzt, um Menschen in Küstengebieten besser vor Extremwetterereignissen wie Wirbelstürmen zu schützen, betonte er.
„An alle, die demonstriert, verhandelt, beraten, berichtet und mobilisiert haben: Gebt nicht auf! Die Geschichte ist auf Eurer Seite!“
Die Weltgemeinschaft hatte sich mit dem Pariser Abkommen 2015 darauf verständigt, dass die Industrieländer bis 2025 jährlich 100 Milliarden US-Dollar an Klimahilfen mobilisieren. Der Bundesregierung zufolge lag der deutsche Beitrag im vergangenen Jahr bei sechs Milliarden Euro. Umwelt- und Entwicklungsorganisationen verweisen auf die aktuellen Haushaltsplanungen für 2026 und befürchten, dass Deutschland seine Zusagen für die kommenden Jahren nicht einhalten wird.
Kein Plan für Abkehr von fossilen Brennstoffen
Dass die Welt sich von Kohle, Öl und Gas verabschieden soll, haben die Staaten bereits vor zwei Jahren auf der UN-Klimakonferenz in Dubai beschlossen, auch hier jedoch ohne konkrete Zwischenziele und Fristen zu nennen. Anders als erhofft, wurde das auch in Belém nicht präzisiert.
Abseits der offiziellen Agenda machte sich zwar eine Gruppe von 80 Ländern des Globalen Südens und Industriestaaten wie Deutschland für einen konkreten Ausstiegsfahrplan stark. Doch vereinbart wurde am Ende lediglich eine freiwillige Initiative, um die Klimaschutz-Anstrengungen der Staaten zu beschleunigen. Auf der Bremse standen große Schwellenländer wie China und Indien sowie Öl-Staaten wie Saudi-Arabien und Russland. Immerhin: Südkorea verpflichtete sich in Belém dazu, keine neuen Kohlekraftwerke mehr zu bauen und seinen Bestand an Kohlemeilern schrittweise zu reduzieren.
Konferenzpräsident André Corrêa do Lago machte nach Annahme der Abschlusserklärung einen ungewöhnlichen Schritt: Er kündigte außerhalb des offiziellen Beschlussprozesses eine eigene Initiative zur Erarbeitung eines Fahrplans zum Ausstieg aus den Fossilen an. Unter anderem verwies er auf hochrangige Gespräche und eine Konferenz in Kolumbien 2026. Deutschland hat dafür bereits Unterstützung zugesagt.
Weiter Unklarheit über Erreichung des 1,5-Grad-Ziels
Auf der Pariser Klimakonferenz hatten sich die Staaten auch darauf geeinigt, die Erderwärmung auf 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau zu beschränken. Doch auch zehn Jahre später haben die Staaten in Belém nicht festgelegt, wie sie das konkret erreichen wollen. Laut einer UN-Analyse steuert die Welt auf eine Erhöhung der Temperaturen von 2,8 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts hin.
Allerdings bekannten sich parallel zum Klimagipfel die G20-Staaten in Südafrika zur verstärkten Bekämpfung des Klimawandels. Sie sind für den Mammutanteil der weltweiten Emissionen verantwortlich. Die USA unter Präsident Donald Trump boykottierten den Gipfel jedoch.
Investitionen in neuen Tropenwald-Fonds bleiben hinter Erwartungen zurück
Gastgeber Brasilien nutzte die Klimakonferenz, um für Unterstützung für einen neu aufgelegten Fonds zum Schutz von Tropenwäldern, die Tropical Forest Forever Facility (TFFF), zu gewinnen. Er soll nach dem Willen der brasilianischen Regierung ein Volumen von 125 Milliarden US-Dollar aus öffentlichen und privaten Investitionen haben und Länder, die ihre Wälder schützen, belohnen. Umgekehrt sollen sie für jeden zerstörten Hektar Wald Strafe zahlen. Überprüft werden soll das mit Satellitenbildern.
Größerer Teil soll indigenen Völkern zugute kommen
Doch auch die Brasilianer konnten sich mit ihren ehrgeizigen Zielen nicht durchsetzen. Weder wurde ein Zeitplan für ein Ende der Entwaldung beschlossen, noch kam genug Geld für den Regenwaldfonds zusammen. Mindestens zehn Milliarden Dollar wollte Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva in Belém einsammeln. Doch es wurden nur knapp über 6,7 Milliarden Dollar, davon eine Milliarde Euro aus Deutschland.
Insgesamt könnten gut 70 Entwicklungsländer vom TFFF profitieren. Die Empfänger sollen selbst entscheiden dürfen, wie genau das Geld verwendet wird, allerdings sind Projekte mit fossilen Brennstoffen tabu. Eine wichtige Verpflichtung ist aber, dass 20 Prozent speziell für indigene Völker und traditionelle Gemeinschaften bereitgestellt werden.
Die Leitung des Fonds übernimmt ein Exekutivrat aus 18 Ländern – je zur Hälfte Tropenwaldländer und Industriestaaten. Als Treuhänder springt zunächst die Weltbank ein.
Keine konkreten Beschlüsse zu den Rechten indigener Völker
2.500 Vertreter und Vertreterinnen indigener Gemeinschaften sollen laut der Vereinigung der Indigenen Völker Brasiliens (APIB) zur Weltklimakonferenz nach Belém gereist sein – so viele wie noch nie bei einer Klimakonferenz. Doch nur 14 Prozent von ihnen, also etwa 360 Personen, haben laut APIB eine Akkreditierung für die Blaue Zone erhalten, dem Bereich, in dem die offiziellen Verhandlungen stattfinden und man sich bei Diskussionsveranstaltungen einbringen kann.
Umso lautstärker machten sie außerhalb auf sich aufmerksam: Bei zahlreichen Protesten in Belém forderten die indigenen Gemeinschaften einem Stopp der vom Menschen verursachten Erderwärmung, die Abkehr von klimaschädlichen fossilen Energien sowie einen besseren Schutz im Amazonasgebiet und ein größeres Mitspracherecht bei der Verabschiedung entsprechender Maßnahmen.
Brasilien will zehn neue Schutzgebiete schaffen
Im Abschlussdokument findet sich nur ein vager Absatz zu ihren Forderungen. Darin heißt es, man erkenne die Rechte indigener Völker an. Die brasilianische Regierung gab außerdem die Grenzziehung für zehn neue Schutzgebiete bekannt.
Uno-Generalsekretär António Guterres gestand am Ende der Abschlussplenarsitzung ein, dass wahrscheinlich viele vom Klimagipfel enttäuscht seien – insbesondere junge Menschen, indigene Völker und alle, die unter den Folgen des Klimawandels leiden. "An alle, die demonstriert, verhandelt, beraten, berichtet und mobilisiert haben: Gebt nicht auf! Die Geschichte ist auf eurer Seite!", ermutigte er die Aktivisten.
Hoffnung auf die nächste Klimakonferenz in der Türkei
Die nächste Weltklimakonferenz soll im kommenden Jahr im türkischen Badeort Antalya stattfinden, mit einer besonderen Rolle für Australien. Dieser ungewöhnliche Kompromiss ist Ergebnis von monatelangen Streitereien zwischen der Türkei und Australien um den Tagungsort. Der deutsche Umweltstaatssekretär Jochen Flasbarth erklärte dazu, die Türkei solle "Gastgeber und Präsidentschaft" der nächsten Klimakonferenz werden, Australien hingegen "Präsidentschaft für die Verhandlungen".
Die Austragung der jährlichen Weltklimakonferenz rotiert zwischen den Weltregionen, die Staatengruppen müssen sich jeweils auf einen Gastgeber einigen.
Mehr Hintergründe zum Thema
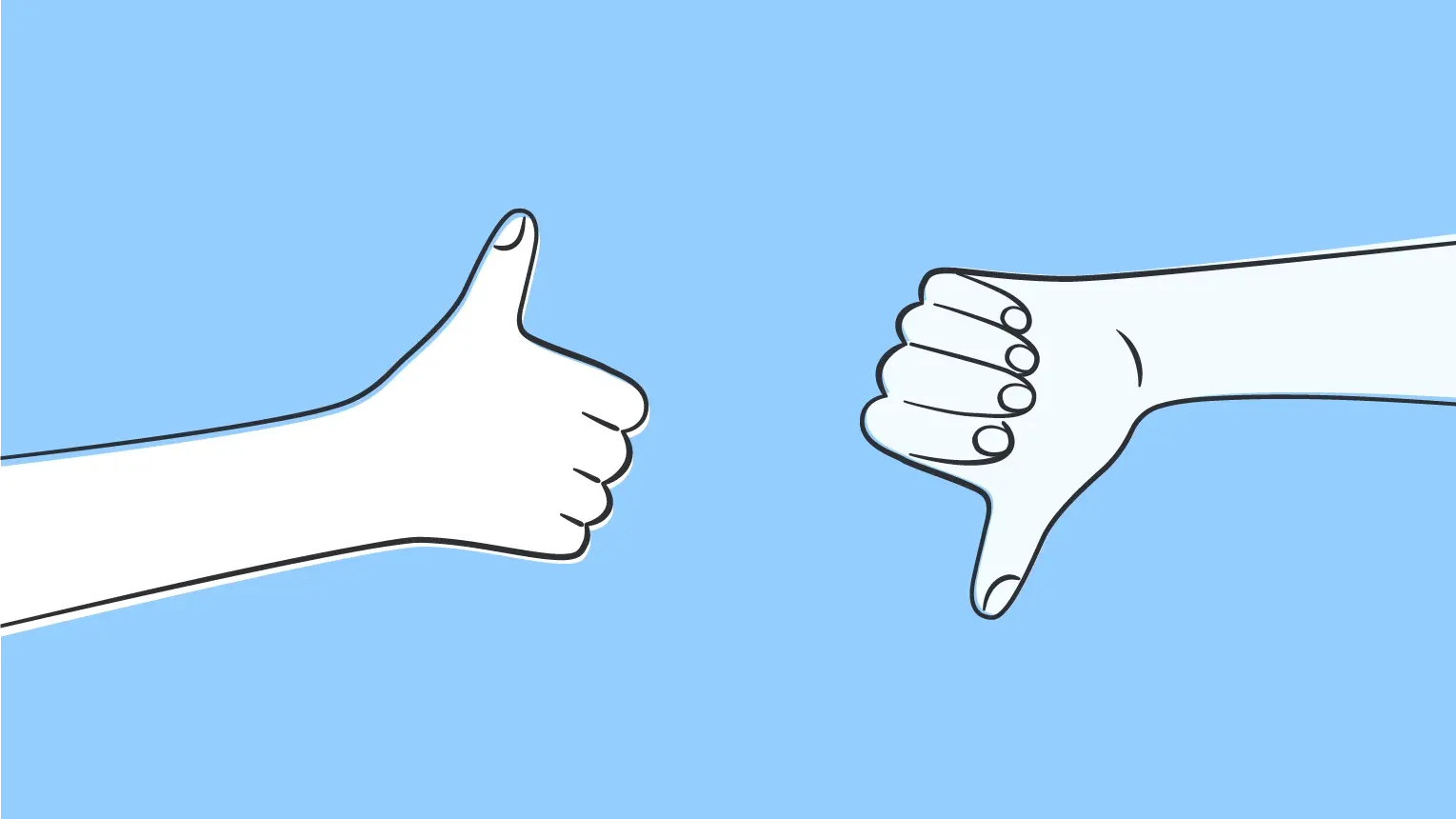
Sollte die Europäische Union ihre Regeln für den CO2-Emissionshandel lockern? Daniel Wetzel ist dafür, Thomas Hummel hält dagegen: ein Pro und Contra.

Zahlreiche Absichtserklärungen haben die Erderwärmung bislang nicht stoppen können. Kann der am Montag in Brasilien gestartete 30. Weltklimagipfel die Wende bringen?

Der Bundestag beschließt einen leicht steigenden Umwelt-Etat, streitet aber heftig über Deutschlands Rolle im Kampf gegen den Klimawandel.

