Russland und seine Nachbarn : Die Angst vor der Rückkehr des Imperiums
Der Historiker Oliver Jens Schmitt zeigt in seinem Buch über Russlands westliche Anrainerstaaten, wie massiv diese sich bedroht fühlen.
Ein doppelter Perspektivwechsel bestimmt das Buch des Historikers Oliver Jens Schmitt über "Moskaus westliche Rivalen". Europäische Geschichte wird hier nicht wie gewohnt mit dem Blick von West nach Ost beschrieben, sondern entlang der Nord-Süd-Achse, vom Nordkap bis ans Schwarze Meer. Zugleich distanziert sich diese Publikation von einer Betrachtungsweise, die ganz auf Moskau als einzig relevantem Bezugspunkt fixiert ist.

Anlässlich des Nato-Beitritts Finnlands hat die kleine finnische Brauerei Olaf Brewing das Bier „Otan Olutta“ gebraut. Während „Olutta“ Bier bedeutet, ist „Otan“ nicht nur die französische Abkürzung für Nato, sondern bedeutet im Finnischen auch „Ich nehme“.
Für diesen Perspektivwechsel hat der Autor einen triftigen Grund. Im westlichen Europa galt alle Aufmerksamkeit immerzu Russland; der Raum zwischen Berlin und Moskau blieb dabei meist außer Betracht. Die Stimmen der dort lebenden Völker zählten in weiten Kreisen wenig. Regierende im westlichen Europa schlugen etwa nach der Krim-Annexion durch Russland 2014 die Warnungen der Balten und Polen vor den Absichten von Präsident Wladimir Putin in den Wind.
Russlands westliche Nachbarn sind näher zusammengerückt
Russlands Frontalangriff auf die Ukraine im Februar 2022 brachte die Bruchlinien innerhalb Europas ans Licht. Die Anrainer Russlands reagierten auf den russischen Überfall anders als die Staaten weiter im Westen des Kontinents. "Sie alle fühlten sich unmittelbar betroffen," konstatiert Schmitt, "und sie alle verstanden die Gefahr, die nicht nur der Ukraine, sondern auch ihnen und ganz Europa drohte, deutlich besser als die Gesellschaften in der Mitte und im Westen des Kontinents." Russlands westliche Nachbarn sind enger zusammengerückt und bilden jetzt eine Art Interessengemeinschaft innerhalb Europas; Finnland und Schweden traten gar der Nato bei.
Dieses gemeinsame Agieren dürfte stark mit historischen Erfahrungen zu tun haben. Schmitt ist davon überzeugt, dass die Ereignisse der Gegenwart beträchtlich von jahrhundertealten Konstellationen bedingt sind. Er entfaltet daher in seinem Buch ein großes historisches Panorama. Zweimal stand demnach der osteuropäische Raum direkt unter Moskaus imperialer Herrschaft - zuerst im Zarenreich (bis 1917), danach in der Sowjetunion (bis 1989/1991).
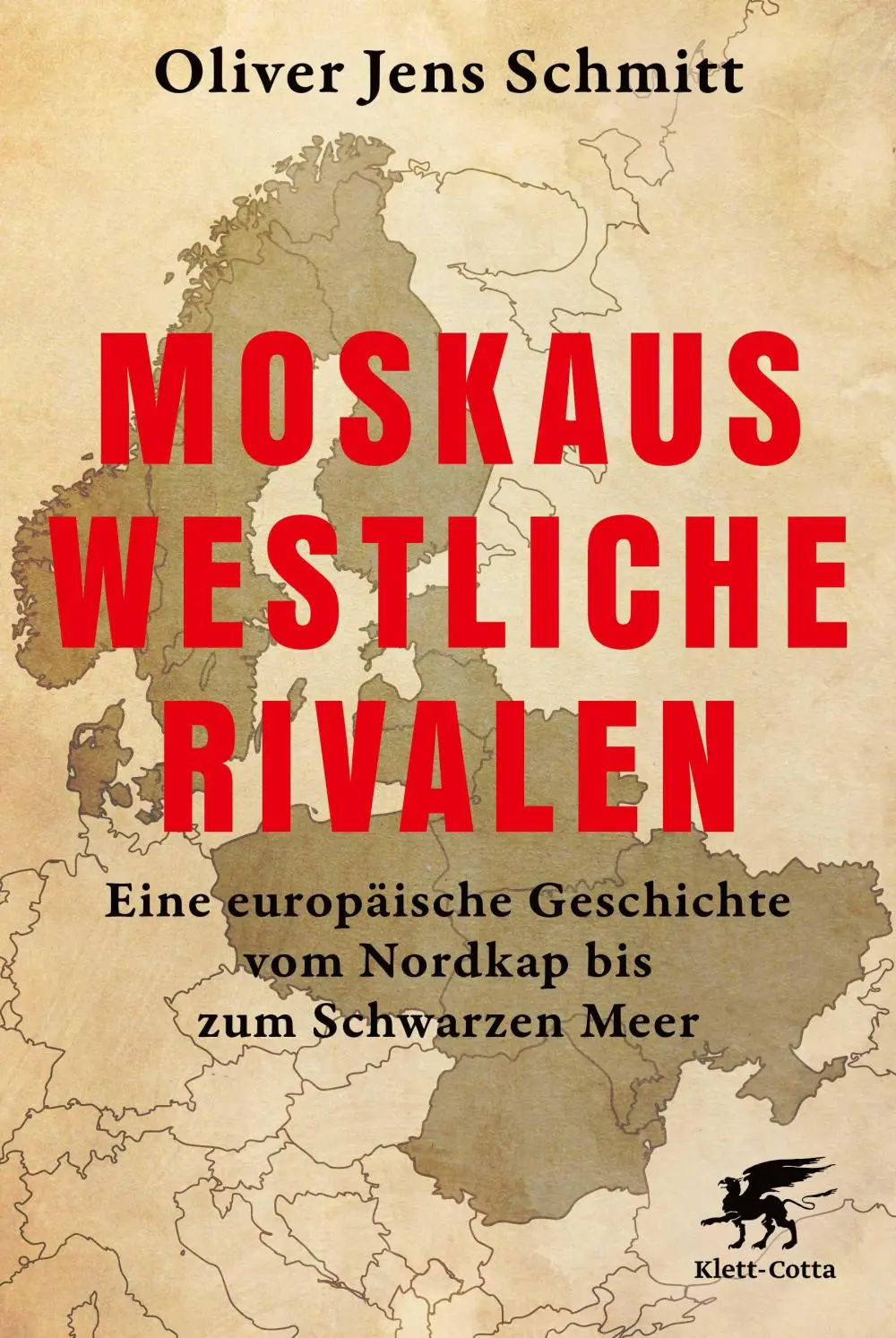
Oliver Jens Schmitt:
Moskaus westliche Rivalen.
Eine europäische Geschichte vom Nordkap bis zum Schwarzen Meer.
Klett-Cotta,
Stuttgart 2025;
476 S., 32,00 €
Man erkennt anhand dieser detailreichen Darstellung, dass die Grundmuster von Moskaus Aktionen gegenüber seinen westlichen Nachbarn schon früher existiert haben. Als russische Truppen 2014 in der Ukraine einfielen, entsprach dies jener Vorgehensweise, die mehr als 500 Jahre zuvor Iwan III. angewendet hatte: Angriffe, aber nicht unter eigener Fahne; das Abstreiten der Aggression; die Bereitschaft zu einem Zermürbungskrieg. Russlands große Attacke auf die Ukraine ab 2022 ist ebenfalls nicht neuartig, sondern steht in einer Reihe von Überfällen auf die westlichen Nachbarn. Die ersten Angriffskriege gegen Schweden und Livland (Estland/Lettland) hat es bereits im 15. und 16. Jahrhundert gegeben.
Mit besonderer Spannung liest man deshalb im Schlussteil des Bandes das politische Fazit des Autors. Oliver Jens Schmitt zeigt nicht nur, dass Russlands imperiale Ansprüche weit in die Geschichte zurückreichen. Er verweist auch darauf, dass Russland unter Putin danach trachtet, das Imperium wiederherzustellen.
Selbst die russische Opposition war imperialen Überzeugungen verhaftet
Die ganze Denkweise der Moskauer Führung hat sich folglich im vergangenen halben Jahrtausend wenig verändert. In Russland dachte sogar die liberale Opposition zur autokratischen Macht kaum anders als Zaren oder Sowjetführer. Auch sie blieb meist imperialen Überzeugungen verhaftet.
Russlands westliche Nachbarn hätten also allen Grund zur Sorge um ihre Sicherheit, betont Schmitt. In der geschichtlichen Betrachtung erweise sich, dass nur jene Nachbarn Moskaus langfristig überleben könnten, die bereit und fähig seien, sich militärisch zu verteidigen und sich zu diesem Zweck mit politisch Gleichgesinnten zu verbünden.
Vom Moskauer Machtsystem trennt Russlands westliche Nachbarn eine gänzlich andere politische Kultur. In diesem Raum sind Formen politischer Mitbestimmung der Bürger in Institutionen sowie Konzepte von Freiheit und Recht entstanden, die sich in Russland nie nachhaltig haben entwickeln können. Stets war die Zeitspanne nur kurz, in welcher dort ein Aufbruch zur Demokratie möglich schien. Zuletzt scheiterte in Russland ein System mit freien Wahlen und freiem Parlament Mitte der 1990er Jahre. Dass sich die Ukraine in mehreren Anläufen immer weiter nach Westen bewegte, zuerst in der "Orangenen Revolution" 2004 und dann im "Euromaidan" 2013/2014, löste folglich bei den autokratisch eingestellten Machthabern in Moskau Alarm aus.
Die Erfahrung mit dem Moskauer Imperium hat bei Ukrainern, Balten oder Polen Kulturen des Widerstands hervorgebracht. Nach dem Fall der Sowjetunion sind demokratische Staaten aufgeblüht. Diese Länder seien politisch, kulturell, mental dem Westen des Kontinents noch nie so nahe gewesen wie heute, bilanziert Schmitt. Dies belege der Aufstand gegen die Diktatur in Belarus 2020 ebenso wie der Wahlsieg der westlich ausgerichteten Präsidentin Maia Sandu in Moldau 2024.
