Deutsche Militärgeschichte : Von Hellebarden und Musketen zu Drohnen und Raketen
Der Historiker Stig Förster blickt zurück auf 600 Jahre "Deutsche Militärgeschichte" - und zeigt die dramatischen Wechselwirkungen zwischen Politik und Militär auf.
Es sind zornige, anklagende Worte, die ein namentlich nicht genannter Stabsfeldwebel der Bundeswehr im April 2008 während seines Einsatzes in Afghanistan in sein Tagebuch notiert: "Wenn wer hier in den Bergen überhaupt eine Chance hat, dann Gebirgsjäger. Wenn nicht wir, wer dann? Aber wo sind sie, die Jäger? Weggespart, wegentschieden, totgeredet. Alles im Arsch! Politik ist nur noch ein Scheiß." Und wenige Zeilen später fügt er erbost an: "Aber die Leute, die so was entscheiden, achten nur auf ihre Wähler, opportunistische Hunde."

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu Besuch bei der Gebirgsjägerbrigade 23 im Juli 2023.
Solche von Frustration gezeichneten Äußerungen von Soldaten über eine politische Führung, von der sie sich im Stich gelassen fühlen, sind wohl aus allen Kriegen zu allen Zeiten überliefert. Sie sind aber eben auch ein Beleg dafür, wie eng politische Geschichte mit Militärgeschichte verknüpft ist. Nicht ohne Grund lässt der renommierte deutsche Militärhistoriker Stig Förster den Stabsfeldwebel quasi exemplarisch in seinem rund 1.300 Seiten umfassenden Monumentalwerk über die "Deutsche Militärgeschichte" zu Wort kommen.
Deutlich facettenreicher als nur eine politische Allgemeingeschichte
Militärgeschichte sei ein "integraler Bestandteil der Allgemeingeschichte", betont Förster. Gerade die deutsche Geschichte könne ohne die Rolle des Militärischen kaum verstanden werden. Und dies ist dann eben auch der rote Faden, den der Historiker zu spinnen versucht - von der Zeit der Landsknechte im 16. Jahrhundert, die mit Hellebarden und Musketen von Angesicht zu Angesicht aufeinander einschlugen, bis hin zu den modernen Armeen dieser Tage, die sich mit Drohnen und Raketen über Hunderte bis Tausende Kilometer hinweg bekämpfen.
Dass der rote Faden in der faktengesättigten Darstellung Försters, die sich über 600 Jahre erstreckt, mitunter droht, verloren zu gehen, liegt in der Natur der Sache. Militärgeschichte ist dann eben doch deutlich facettenreicher als nur eine politische Allgemeingeschichte, die um die Darstellung von Kriegen und Schlachten und der Streitkräfte, die sie ausfochten, erweitert wird. Technikgeschichte spielt ebenso eine große Rolle wie Wirtschafts- oder Medizingeschichte, Soziologie eine ebenso große wie Kultur- und Mentalitätsgeschichte. All diesen Aspekten will Förster gerecht werden. Dies ist es schließlich, was ein gelungenes Standardwerk auszeichnet, und Förster gelingt es, eine ausgewogene Balance zwischen all diesen Themenkomplexen zu halten. Zudem hält er im Anhang des Buches eine nach Kapiteln geordnete Literaturliste für eine vertiefende Lektüre zu all diesen Aspekten bereit.
Die Wiederbewaffnung stand im Zeichen der Westbindung
Als "Spielball der Politik" bezeichnete der "Zeit"-Journalist Hauke Friedrichs die Bundeswehr in seinem vor zwei Jahren erschienenen gleichnamigen Buch. Man mag solche zugespitzten journalistischen Überschriften ablehnen, aber auch der Wissenschaftler Förster zeigt auf, dass die Geschichte der Bundeswehr von Entscheidungen der politischen Führung geprägt ist, die vor allem von politischen und nur zweitrangig von militärischen Gesichtspunkten geprägt wurden. Bereits die Gründung der Bundeswehr im Jahr 1955 stand ganz im Zeichen der von Bundeskanzler Konrad Adenauer (CDU) angestrebten Westbindung und dem Wunsch nach mehr eigenstaatlicher Verantwortung. Und die Bundeswehr sollte hierfür die Türen öffnen. Die Zusage an die Nato-Verbündeten jedoch, die neuen westdeutschen Streitkräfte in nur wenigen Jahren regelrecht aus dem Boden zu stampfen, stellte die Militärs vor größte Probleme.
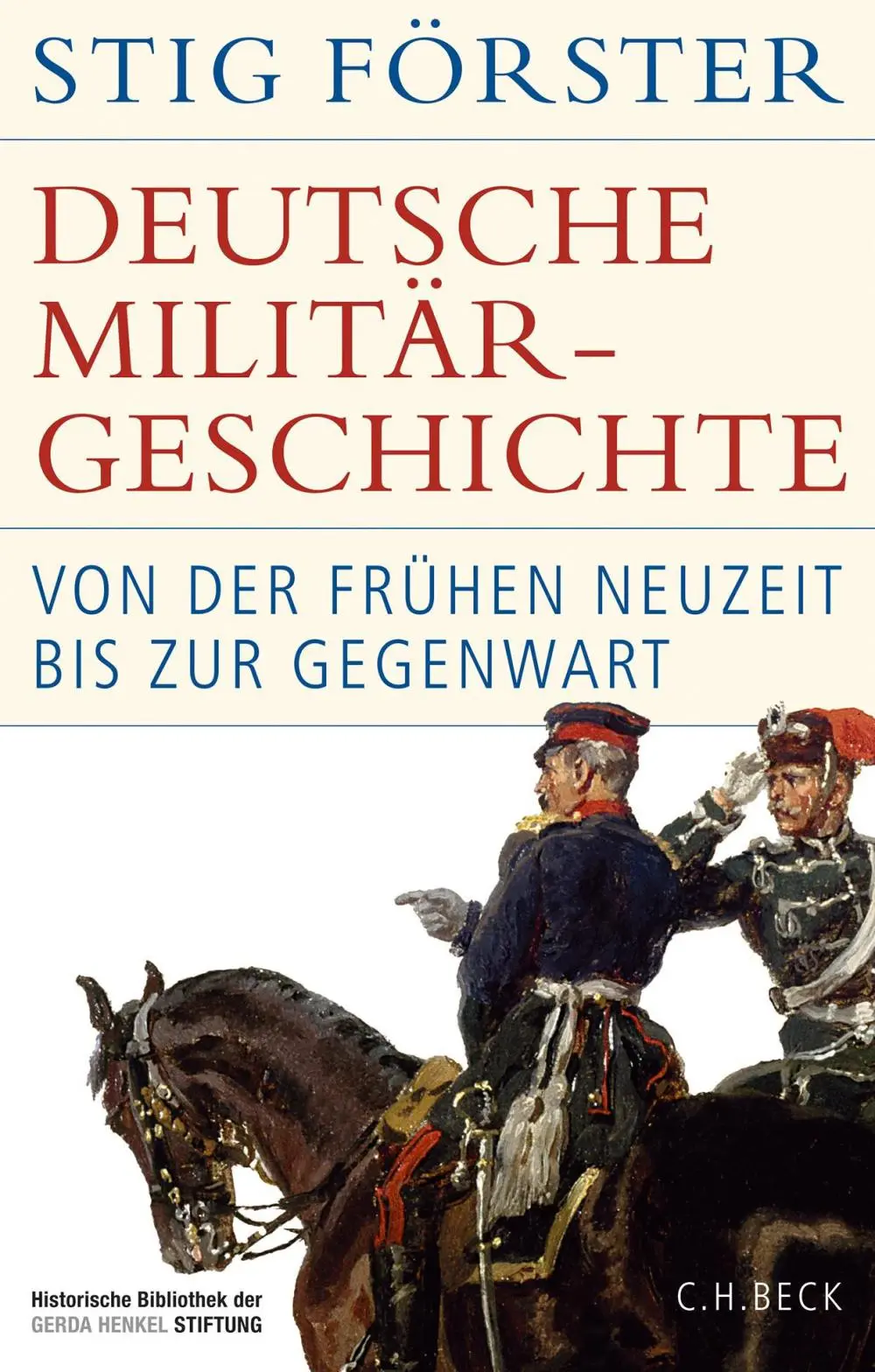
Stig Förster:
Deutsche Militärgeschichte.
Von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart.
C.H. Beck,
München 2025;
1.294 S., 49,90 €
Nach Ende des Kalten Krieges und der wiedererlangten Einheit Deutschlands wiederholte sich dieses Spiel. Die Bundeswehr wurde in immer schnellerer Folge in diverse Auslandseinsätze entsandt. Deutschland wollte als zuverlässiger Partner erscheinen. Die Bundeswehr war auf die neuen Herausforderungen jedoch nur unzureichend vorbereitet. Gleichzeitig wurde sie angesichts einer sich leerenden Staatskasse immer weiter verkleinert und abgerüstet. Unter den Folgen leidet die Truppe bis heute. Völlig zu Recht wurden die deutschen Streitkräfte 1955 konsequent unter den Primat der Politik gestellt. Die vor drei Jahren ausgerufene "Zeitenwende" wird bei der Bundeswehr jedoch nur erfolgreich umgesetzt werden können, wenn militärische Notwendigkeiten nicht länger ignoriert werden. Auch daran lässt Förster keinen Zweifel.
Militärhistoriker standen in Deutschland nach der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs in keinem besonders guten Ruf. Trotz Wiederbewaffnung machte man auch in akademischen Kreisen gerne einen großen Bogen um dieses Gebiet der Geschichtsschreibung. Aber Militärgeschichte, so hält Förster dagegen, sei viel zu wichtig, um sie "Waffennarren und Lehnstuhlfeldherren" zu überlassen. Es bedürfe "einer seriösen wissenschaftlichen Aufarbeitung mit Bezug auf die Allgemeingeschichte". Diesem selbstgesetzten Anspruch ist Stig Förster vollumfänglich gerecht geworden.

Militärhistoriker Sönke Neitzel über die Bundeswehr, ihr Selbstverständnis und ihre Traditionen sowie den Wunsch nach militärischen Vorbildern in den Kampftruppen.
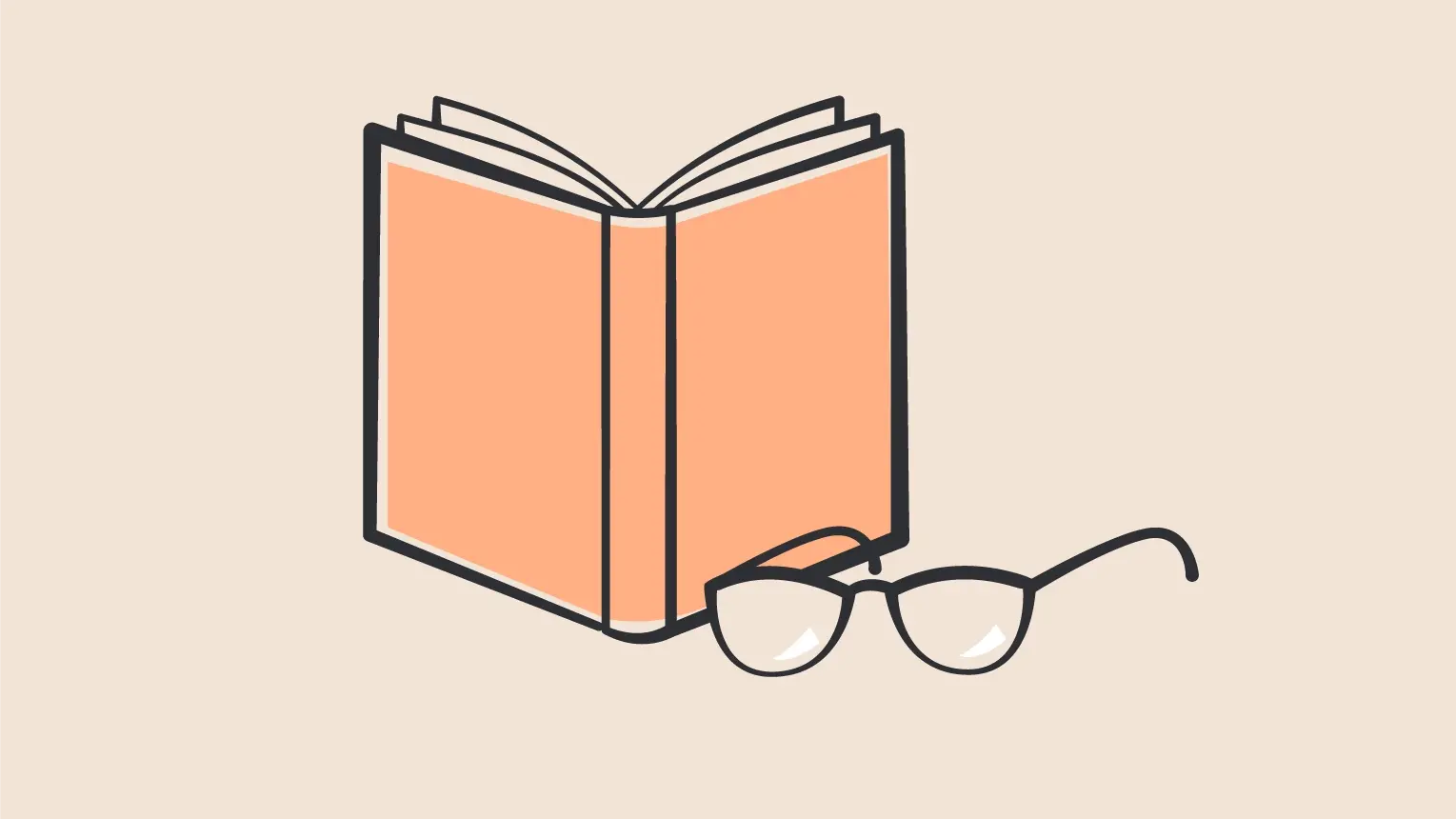
Der Militärhistoriker Sönke Neitzel blickt in seinem neuen Buch zurück auf 70 Jahre Bundeswehr. Und er fordert ein Umdenken in der Verteidigungspolitik.

Noch 1962 fehlte der Bundeswehr Personal und Ausrüstung, doch ab Mitte der 1970er Jahre galt sie als die stärkste konventionelle Armee Europas.
