Investitionsstau im Gesundheitswesen : Krankenhausreform stellt System vor Herausforderungen
Viele Krankenhäuser müssen saniert und klimaneutral umgebaut werden. Die Kosten sind hoch, die Länder investieren zu wenig. Das soll sich nun ändern.
Die rund 1.700 Krankenhäuser in Deutschland gehören zur Kritischen Infrastruktur und müssen als Teil der Daseinsvorsorge in einem guten Zustand verfügbar sein. Die Krankenhauslandschaft genießt tatsächlich einen guten Ruf, auch international, wenngleich Gesundheitsexperten zu kritischen Urteilen neigen.

Schlechte Dämmung, fehlender Hitzeschutz: Manche Krankenhäuser - hier der alte Campus der Berliner Charité - sind in Altbauten untergebracht, die energetisch saniert werden müssen.
Die Bausubstanz ist an vielen Stellen in die Jahre gekommen, die Länder kommen ihren Investitionsverpflichtungen nur unzureichend nach, und auch die Krankenhausstruktur ist nach Einschätzung von Fachleuten ungeeignet, um die Versorgung der Patienten langfristig effizient und mit hoher Qualität und der nötigen Spezialisierung zu gewährleisten.
Transformationsfonds im Umfang von 50 Milliarden Euro vor
Als Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) in der vergangenen Legislatur an die große Krankenhausreform ging, um genau dies zu ändern, sprach er selbst von einer "Revolution". Skeptiker aus den Ländern ließen an dem im Oktober 2024 verabschiedeten Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz (KHVVG), das auch eine teilweise Abkehr von den umstrittenen Fallpauschalen vorsieht, sowie an dem zugehörigen Vorschaltgesetz, dem Krankenhaustransparenzgesetz mit einem Klinik-Atlas und Versorgungsstufen (Level), zeitweilig kaum ein gutes Haar.
Weil die Reform aus Sicht der Kliniken mit großen Finanzrisiken behaftet ist und viele Häuser schon Verluste schreiben, sieht das Reformgesetz einen Transformationsfonds im Umfang von 50 Milliarden Euro vor, der zur Hälfte von den Ländern und zur anderen Hälfte vom Bund getragen werden soll. Gestreckt über zehn Jahre (2026 bis 2035) ergibt das eine Finanzspritze in Höhe von fünf Milliarden Euro jährlich, sofern die Länder mitziehen.
Viele Krankenhäuser sind von Insolvenz bedroht
Ursprünglich sah der Gesetzentwurf vor, den Bundesanteil aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds zu entnehmen, was zu einem Aufschrei der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) führte und von Finanzfachleuten als ungeeigneter Finanzierungsweg gebrandmarkt wurde, schließlich sei die Krankenhausreform ein gesamtgesellschaftliches Vorhaben, das aus Steuermitteln finanziert werden müsse.
Union und SPD haben im Koalitionsvertrag eine finanzpolitische Kehrtwende vollzogen. Dort heißt es: "Die Lücke bei den Sofort-Transformationskosten aus den Jahren 2022 und 2023 sowie den bisher für die GKV vorgesehenen Anteil für den Transformationsfonds für Krankenhäuser finanzieren wir aus dem Sondervermögen Infrastruktur." Unter dem Titel Sofort-Transformationskosten sind in dessen Wirtschaftsplan bereits 1,5 Milliarden Euro vorgesehen.
„Die Bestandsinvestitionen sind unabhängig vom Transformationsfonds weiterhin erforderlich und müssen zusätzlich aufgebracht werden.“
Insgesamt hat die neue Bundesregierung Soforthilfen für die Krankenhäuser in Höhe von vier Milliarden Euro zugesagt, verteilt auf zwei Jahre, mit denen Kostensteigerungen aufgefangen werden sollen. Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gaß, wertete dies als "starkes Signal". Das Geld trage dazu bei, die wirtschaftliche Not vieler Kliniken zu lindern. Die Bundesregierung müsse jetzt "für echte Deregulierung und Entbürokratisierung sorgen". Die Krankenhausreform selbst, die von der Union teilweise kritisch gesehen wird, soll in ihren Zielen nicht aufgegeben, sondern weiterentwickelt werden.
Regierungskommission empfiehlt dauerhaften Fonds für Investitionen
Mit den Milliarden für den Transformationsfonds ist die Finanzierung der Häuser aber keineswegs abgeschlossen, wie aus der 13. Stellungnahme der im Mai 2022 eingesetzten Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung vom März 2025 hervorgeht. In dem Bericht verweist die Kommission auf den Unterschied zwischen Bestands- und Strukturinvestitionen. Bei Bestandsinvestitionen gehe es um den Erhalt des Anlagevermögens, also Immobilien, Geräte oder medizinische Infrastruktur. Die Kommission sieht den Bedarf für Bestandsinvestitionen bei sechs bis acht Milliarden Euro pro Jahr oder etwa sieben bis neun Prozent der Krankenhauserlöse.
Mit Strukturinvestitionen werden Anpassungen der Krankenhauslandschaft finanziert, also Neubauten, Erweiterungen oder Umbauten zum Zweck einer stärkeren ambulanten Versorgung sowie die Zusammenlegung oder Schließung von Standorten. Hier empfiehlt die Kommission einen dauerhaft eingerichteten Fonds mit hälftiger Finanzierung von Bund und Ländern.
Investitionskosten fallen in die Zuständigkeit der Länder
Die Mittel aus dem Transformationsfonds dienen der Kommission zufolge ausschließlich den Strukturinvestitionen im Sinne der Reform. Förderfähig seien beispielsweise die Bildung von Krankenhausverbünden, die Schaffung integrierter Notfallstrukturen, die Erfüllung der Qualitätskriterien, die Umwandlung von Häusern in sektorenübergreifende Versorgungseinrichtungen (Level 1i), die Bildung telemedizinischer Netzwerkstrukturen oder die Vernetzung von Kliniken mit Spezialkompetenzen.
Mehr zur Krankenhausreform

Mit der Krankenhausreform sollen sich Kliniken spezialisieren. Neu sind Pauschalen für die Vorhaltung bestimmter Leistungen.
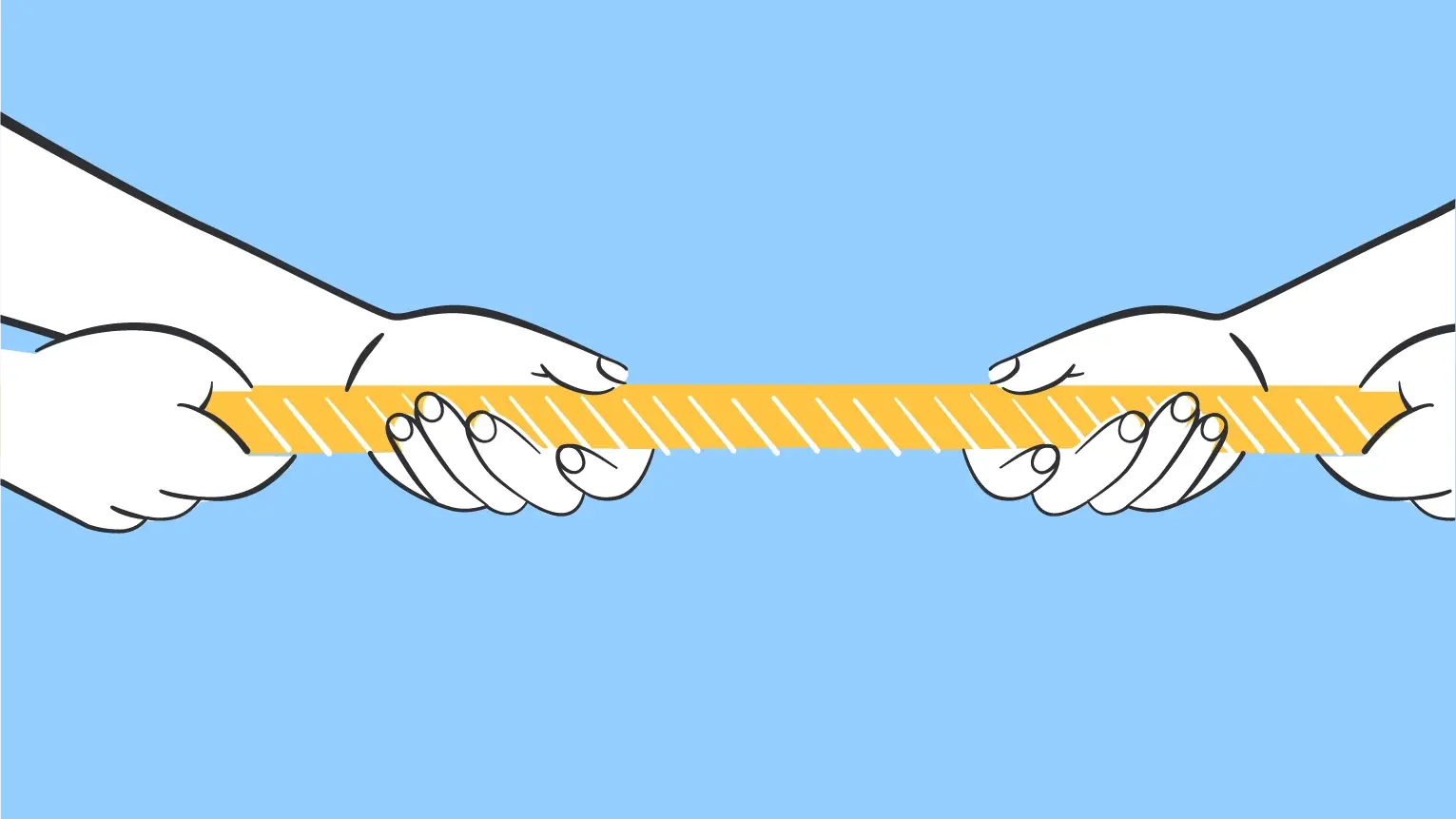
Braucht es bei der Krankenhausreform Ausnahmen für Kliniken im ländlichen Raum? Timot Szent-Iványi ist dafür, Kerstin Münstermann findet, das ist der falsche Weg.

Mit der Krankenhausreform sollen sich Qualität und Effizienz der Versorgung verbessern. Geplant ist eine Struktur- und Finanzreform.
Die Kommission stellt klar, dass die grundlegende Umstrukturierung der Krankenhausversorgung ohne zusätzliche Strukturinvestitionen nicht zu erreichen ist. Und weiter: “Die Bestandsinvestitionen sind unabhängig vom Transformationsfonds weiterhin erforderlich und müssen zusätzlich aufgebracht werden.”
Genau hier liegt der Knackpunkt, denn die Länder kommen seit vielen Jahren ihren gesetzlich vorgeschriebenen Investitionsverpflichtungen für die Krankenhäuser nicht nach. Mit dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) von 1972 wurde die duale Finanzierung eingeführt. Demnach werden die Betriebskosten der Kliniken, vor allem Personal- und Behandlungskosten, von der Krankenversicherung finanziert. Die Investitionskosten, die etwa Bauprojekte oder die Anschaffung von Geräten umfassen, fallen ebenso wie die Krankenhausplanung in die Zuständigkeit der Länder.
Investitionsstau im Gesundheitswesen liegt bei 30 bis 50 Milliarden Euro
Nach Angaben des GKV-Spitzenverbandes (GKV-SV) entsprachen die Investitionsmittel der Länder Anfang der 1970er-Jahre noch 25 Prozent der Gesamtausgaben der GKV, inzwischen seien es weniger als vier Prozent. Gesundheitsökonomen haben errechnet, dass der Investitionsstau grob geschätzt inzwischen bei 30 bis 50 Milliarden Euro liegt. Nicht wenige Krankenhäuser nehmen Einnahmen aus dem Betrieb, um Investitionen zu finanzieren.
Laut dem "Katalog der Investitionsbewertungsrelationen", auf den sich die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG), der GKV-SV und die Private Krankenversicherung (PKV) verständigt haben, liegt der "bestandserhaltende Investitionsbedarf" der Kliniken bei rund 6,5 Milliarden Euro pro Jahr. Die Länder deckten aber seit Jahren nur etwa die Hälfte des Bedarfs ab. Dies begrenze dringend erforderliche Investitionen, beispielsweise in die Abwehr von Cyberangriffen, Klimaschutz, Infektions- und Brandschutz sowie die bauliche Modernisierung, heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme der Verbände von April 2024.
„Ein Klinikbett benötigt rechnerisch so viel Energie wie zwei durchschnittliche Einfamilienhäuer.“
Um die Digitalisierung der Häuser voranzubringen und den Investitionsstau zumindest teilweise aufzulösen, beschloss der Bundestag im September 2020 das Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG). Es sah für 2021 Investitionen des Bundes in Höhe von drei Milliarden Euro vor, die Länder sollten 1,3 Milliarden Euro beisteuern. Gefördert wurden Investitionen in die digitale Ausstattung der Häuser: Telemedizin, Robotik, Hightech-Medizin, Dokumentation, IT- und Cybersicherheit.
Fünf Jahre später fällt das Fazit differenziert aus. Das "Digitalradar Krankenhaus" legte im Januar 2025 Ergebnisse einer aktuellen Erhebung vor. Demnach sind im Vergleich zu 2021 erhebliche Fortschritte zu verzeichnen. Projektleiterin Sylvia Thun befand: "Wir haben durch das KHZG in relativ kurzer Zeit einen großen Sprung in die richtige Richtung gemacht." Allerdings sei die Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen.
“Gewaltiger” Investitionsbedarf beim klimagerechten Umbau von Krankenhäusern
Eine große Baustelle ist der nachhaltige Klimaschutz in Krankenhäusern. Viele (Alt)Bauten müssen modernisiert werden. Das betrifft Dämmungen, Heizungen und den Hitzeschutz, der bei Hitzewellen in Krankenhäusern und Pflegeheimen besonders wichtig ist. Dringend benötigt werden effektive Isolierungen und Kühlsysteme sowie eine Verschattung und Begrünung.
Mindestens 31 Milliarden Euro sind laut einem Gutachten des Instituts für Health Care Business (hcb) im Auftrag der DKG nötig, um die Kliniken klimaneutral umzugestalten. Ein Großteil der Summe (23,4 Milliarden Euro) entfällt auf die Sanierung der Gebäudehüllen, also etwa die Dämmung von Fassaden und Dächern.
DKG-Chef Gaß sieht im klimagerechten Umbau der Krankenhäuser einen "gewaltigen" Investitionsbedarf, aber auch eine Chance. Pro Bett und Jahr verbrauche ein Krankenhaus 7.800 Kilowattstunden (kWh) Strom sowie mehr als 300 Liter Wasser täglich. "Ein Klinikbett benötigt rechnerisch so viel Energie wie zwei durchschnittliche Einfamilienhäuser", sagt Gerald Gaß. Durch den Umbau der Krankenhauslandschaft ergebe sich "die einmalige Chance, auch die Klimaneutralität der Krankenhäuser voranzubringen". Für einen Teil der Grundinvestitionen könnten der hcb-Studie zufolge fast sieben Milliarden Euro aus dem Transformationsfonds genutzt werden.
