Anerkennung als NS-Opfer : Der lange Kampf der Verfolgten
Viele Verfolgte des NS-Regimes waren nach 1945 erneuten Diskriminierungen ausgesetzt. Das Buch "Unerwünscht" erzählt ihre bedrückende Geschichte.
"Zuallererst bedeutete das Frühjahr `45 eine Befreiung für die Menschen, die unter dem NS-Terror am meisten litten: die Häftlinge der Konzentrationslager." Dieser Satz aus der Rede von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner anlässlich der Gedenkstunde des Bundestages am 8. Mai zum 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs ist zweifelsohne richtig, aber auch unvollständig.
Denn der Leidenswegs vieler dieser KZ-Häftlinge und anderer Verfolgter der nationalsozialistischen Diktatur endete eben nicht. Nicht nur, weil sie mitunter über Jahrzehnte nicht als NS-Opfer anerkannt wurden, geschweige denn eine Rehabilitation erfahren oder gar Entschädigung erhalten hätten. Sondern auch, weil sie sich erneuten Anfeindungen und Diskriminierungen und mitunter auch staatlichen Repressionen oder gar der Strafverfolgung ausgesetzt sahen.
Kratzer am Image der westdeutschen Demokratie als “Erfolgsgeschichte”
Dieses traurige Kapitel zeichnet die Historikerin Stefanie Schüler-Springorum in ihrem Buch mit dem vielsagenden Titel "Unerwünscht" über den Umgang mit den Verfolgten des NS-Regimes in der Bundesrepublik sowohl analytisch wie auch konkret an exemplarischen Schicksalen eindrücklich nach. Und sie kratzt damit gehörig am Image der westdeutschen Demokratie und ihrer Auseinandersetzung mit den nationalsozialistischen Verbrechen als "Erfolgsgeschichte".
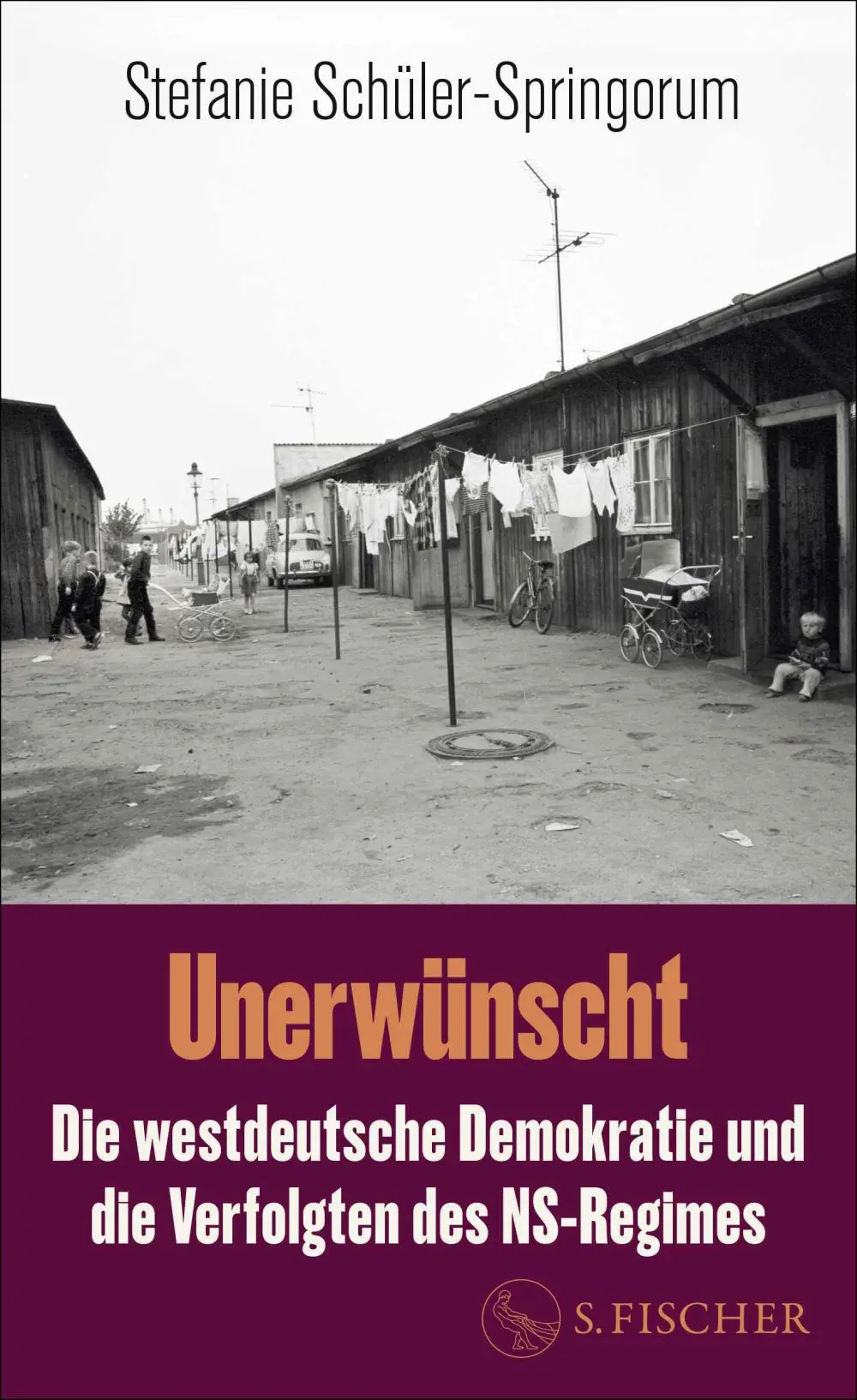
Stefanie Schüler-Springorum:
Unerwünscht
Die westdeutsche Demokratie und die Verfolgten des NS-Regimes.
S. Fischer,
Frankfurt am Main 2024;
256 Seiten, 25,00 €
Konzentriert hat sich die Direktorin des Zentrums für Antisemitismusforschung an der TU Berlin in ihrer höchst lesenswerten Darstellung auf Juden, Sinti und Roma, sogenannte "Erbkranke" und "Asoziale", Zwangsarbeiter und Homosexuelle. Bei aller Unterschiedlichkeit dieser Gruppen einige sie, dass sie "ohne ihr Zutun, aufgrund ihrer bloßen Existenz, ihrer Verfügbarkeit, ihres sozial oder sexuell devianten Verhaltens, einer Krankheit oder einer ,rassisch' definierten Zugehörigkeit verfolgt, versehrt, eingesperrt und ausgebeutet wurden oder ihre geplante Ermordung durch Zufall überlebten".
Gruppen sprachen sich mitunter untereinander den Status als NS-Opfer ab
Das Ausmaß der erneuten Diskriminierungen und Repressalien in Westdeutschland gegenüber diesen Gruppen und die Dauer ihres Kampfes um Anerkennung als NS-Opfer hingegen war höchst unterschiedlich ausgeprägt. Mitunter sprachen sich diese Gruppen auch untereinander den Status als NS-Opfer ab: Etwa im Fall der sogenannten "Asozialen" und "Berufsverbrechern", weil sie von den Nazis oftmals als Hilfs-Aufseher in den Lagern eingesetzt worden waren.
"Unerwünscht" zeigt vor allem, wie lange und wirkmächtig die menschenverachtende Ideologie der Nazis nach 1945 in der Gesellschaft und staatlichen Institutionen nachwirkte.
Weitere Buchrezensionen

Wolfgang Benz wirft in seinem Buch einen kritischen Blick auf die historische Aufarbeitung der zwei deutschen Diktaturen und die Zukunft der Erinnerungskultur.

Der Historiker Stephan Lehnstaedt hat ein wichtiges Werk über den vergessenen und lange verschwiegenen Widerstand von Juden gegen den Holocaust vorgelegt.

1925 wurde Paul Hindenburg zum Reichspräsidenten gewählt. Wolfgang Niess analysiert in "Schicksalsjahr 1925" seine Rolle beim Aufstieg Hitlers.