Überstunden-Zuschläge und Aktivrente : "Kleine Reform für große Probleme: Das wird nicht funktionieren"
Ökonomin Dominika Langenmayr begrüßt steuerliche Anreize für Mehrarbeit. Sie warnt gleichzeitig davor, das Steuersystem noch bürokratischer zu machen.
Frau Professor Langenmayr, die Koalition will Anreize für Mehrarbeit setzen über steuerfreie Überstundenzuschläge und einen steuerfreien Zuverdienst für Rentner. Was halten Sie davon?
Dominika Langenmayr: Es ist richtig, steuerliche Anreize dafür zu setzen, dass Menschen mehr arbeiten. Ich warne aber davor, noch mehr Bürokratie ins Steuersystem zu bringen. Die Steuerfreiheit für Überstundenzuschläge geht mit einem erheblichen Dokumentations- und Prüfaufwand einher. Unternehmen müssten Überstunden und deren Zuschläge genau dokumentieren. Die bereits heute überlasteten Finanzämter müssten die Angaben zu Überstundenzuschlägen bei der Einkommensteuererklärung von Steuerpflichtigen prüfen. Anstatt das Steuersystem, wie im Koalitionsvertrag versprochen, zu vereinfachen, würden steuerfreie Überstundenzuschläge die Einkommensteuer verwaltungsintensiver, komplexer und streitanfälliger machen.

Welchen Effekt erwarten Sie am Arbeitsmarkt?
Dominika Langenmayr: Ein durchschnittlicher Arbeitnehmer hat in Deutschland einen Stundenlohn von brutto 27,28 Euro. Wenn er Vollzeit arbeitet, ergibt sich ein Grenzsteuersatz von 35 Prozent. Wenn nun ein Arbeitgeber seinem Beschäftigten einen Zuschlag auf eine geleistete Überstunde von zehn Euro bezahlt, also insgesamt 37,28 Euro, erhöht die Steuerfreiheit des Überstundenzuschlags den Nettolohn um 3,50 Euro pro Stunde, von 19,17 auf 22,67 Euro. Das ist zu wenig für einen wirklichen Anreiz zu Mehrarbeit. Grund für die hohen Abzüge sind in Deutschland ja nicht nur die Steuern, sondern die hohen Sozialabgaben.
Was wäre, wenn man Überstundenzuschläge auch abgabenfrei stellen würde?
Dominika Langenmayr: Wir können vom Ausland lernen. Frankreich hat vor einigen Jahren eine ganz ähnliche Regelung eingeführt, wie sie die Regierung jetzt plant: Überstundenzuschläge steuer- und abgabenfrei gestellt. Diese Maßnahme ist empirisch sehr gut untersucht worden. Das Ergebnis: Die tatsächliche Arbeitszeit hat sich überhaupt nicht ausgeweitet. Allerdings haben Gutverdiener ihre reguläre Arbeitszeit reduziert, und dafür lieber Überstunden gemacht. Das gilt beispielsweise für Rechtsanwälte. Die konnten so ihr Nettogehalt steigern, mehr gearbeitet wurde unterm Strich aber nicht. Es gab also ausschließlich Mitnahmeeffekte, aber keinen echten Effekt auf das Arbeitsvolumen.
Was wäre ein besserer Anreiz für Mehrarbeit?
Dominika Langenmayr: Die Regierung sollte größer denken. Besonders stark auf Arbeitsanreize reagieren die Empfänger von Bürgergeld. Eine weitere Gruppe, die in Deutschland relativ wenig arbeitet, sind Frauen, die oftmals nur in Teilzeit beschäftigt sind.
„Ein großes Problem in Deutschland sind die vielen Sozialleistungen, die nicht aufeinander abgestimmt sind.“
Was schlagen Sie beim Bürgergeld vor? Hier setzt das Bundesverfassungsgericht doch sehr enge Grenzen für mögliche Reformen.
Dominika Langenmayr: Das Bundesverfassungsgericht lässt hier durchaus Spielräume. Ein großes Problem in Deutschland sind die vielen Sozialleistungen, die nicht aufeinander abgestimmt sind. Wenn Personen mit Kindern mehr arbeiten, dann führt das oftmals dazu, dass die Leistungen um mehr als 100 Prozent sinken. Das heißt: Die Transferentzugsraten sind teilweise zu hoch. Sozialleistungen sollten bei Arbeitsaufnahme langsamer sinken, und wir müssen auch die Zahl der verschiedenen Leistungen konsolidieren.
An welche Leistungen denken Sie dabei?
Dominika Langenmayr: Der größte Effekt ließe sich erreichen, wenn das Wohngeld ins Bürgergeld integriert würde.
Das wäre eine sehr große Reform. Wie realistisch ist das?
Dominika Langenmayr: Wir sind in Deutschland in einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Situation, in der wir über große Reformen nachdenken sollten, und eben nicht nur über kleinere Zuschläge und Prämien.
„Wir sollten weniger Steuergelder für die Rentenversicherung ausgeben und mehr in Bildung investieren.“
Wenn der Staat bei Arbeitsaufnahme weiterhin Sozialleistungen zahlt, dann wird das die klammen öffentlichen Haushalte belasten.
Dominika Langenmayr: Es gibt Vorschläge, die aufkommensneutral sind, etwa jüngst des ifo-Instituts. Aber richtig ist natürlich, dass es sehr viel Geld kostet, wenn die Transferentzugsrate zu weit abgesenkt wird. Nötig ist ein Mittelweg.
Wie wollen Sie Anreize für Frauen setzen, mehr zu arbeiten?
Dominika Langenmayr: Wir sprechen hier über Elternteile, die in der Familienphase ihre Arbeitszeit reduzieren. Entscheidend ist, dass sich die Betreuungssituation verbessert. Das Recht auf Ganztagesbetreuung von Grundschülern ist dabei ein wichtiger Schritt. Aber es geht auch um steuerliche Anreize.
Sie wollen das Ehegattensplitting abschaffen?
Dominika Langenmayr: Das Ehegattensplitting lässt sich schon allein verfassungsrechtlich nicht ersatzlos abschaffen. Man könnte es aber durch einen übertragbaren Freibetrag ersetzen. Das bedeutet, der Ehepartner, der weniger arbeitet, überträgt einen Teil seines steuerlichen Freibetrags auf den anderen Ehepartner. Aber wenn er beispielsweise nach Zeiten der Kinderbetreuung wieder beginnt, zu arbeiten, dann greift bei ihm nicht sofort die hohe Grenzbelastung des anderen.
Eine weitere Maßnahme, die die Koalition plant, ist die Aktivrente. Rentner sollen künftig 2.000 Euro steuerfrei dazuverdienen dürfen. Was halten Sie davon?
Dominika Langenmayr: Das ist ein sinnvoller Ansatz. Viele Rentner können und wollen mehr arbeiten, aber die Anreize sind dafür relativ schlecht. Allerdings soll auch hier eine kleine Reform ein großes Problem lösen, und das wird nicht funktionieren. Das ist derzeit das Hauptproblem in Deutschland: Wir wagen uns nur an minikleine Reförmchen heran, die zwar in die richtige Richtung gehen, aber eben nicht ausreichen. Wir werden alle länger arbeiten müssen, wenn wir unser Rentenniveau auch nur annähernd halten wollen. Sonst müssen die Steuerzuschüsse in die Rentenversicherung immer weiter steigen, was den Bundeshaushalt überlasten wird. Wir sollten weniger Steuergelder für die Rentenversicherung ausgeben, und mehr in Bildung investieren, denn das ist die Zukunft unseres Landes.
„Minijobs sollten stark eingeschränkt werden und ausschließlich bei haushaltsnahen Dienstleistungen möglich sein.“
Der Freibetrag soll zusätzlich zum steuerlich freigestellten Existenzminimum gelten, so dass ein steuerfreies Einkommen von insgesamt bis zu 3.000 Euro möglich ist. Wie bewerten Sie das?
Dominika Langenmayr: Je höher der Freibetrag ist, desto größer ist der Anreiz, zu arbeiten, aber desto stärker fallen eben auch die Mindereinnahmen des Finanzministers aus.
Bereits jetzt sind mit der Aktivrente Steuermindereinnahmen von 890 Millionen Euro in den öffentlichen Haushalten einkalkuliert. Wird das Geld mit der Aktivrente effizient eingesetzt?
Dominika Langenmayr: Sagen wir es so: Die Aktivrente geht in die richtige Richtung. Größere Bauchschmerzen habe ich da mit anderen Vorhaben, insbesondere den steuerfreien Überstundenzuschlägen.
Die Grünen hatten vor der Bundestagswahl vorgeschlagen, Rentnern, die arbeiten, die Arbeitgeberbeiträge zur Renten- und Arbeitslosenversicherung auszuzahlen, die ja oftmals stärker ins Gewicht fallen als Steuern. Wie beurteilen Sie das?
Dominika Langenmayr: Ich kann dem Vorschlag viel abgewinnen. Wenn keine Sozialversicherungsbeiträge mehr abgeführt werden müssen, dürfte der Anreiz, weiter zu arbeiten, für Rentner größer sein, als wenn das Einkommen nur steuerfrei gestellt wird. Allerdings würde das die Rentenkasse belasten.
Die Aktivrente soll nicht für Selbstständige gelten. Wie schwierig wäre es steuersystematisch, die Aktivrente allen Personen im Rentenalter zu gewähren, also auch den Freiberuflern?
Dominika Langenmayr: Systematisch spricht da eigentlich vieles dafür. Die Ungleichbehandlung von Arbeitnehmern und Selbstständigen ist schwer zu rechtfertigen. Allerdings arbeiten viele Selbstständige sowieso weiter, auch wenn sie schon 67 sind. Daher wäre hier mit hohen Mitnahmeeffekten zu rechnen
Was halten Sie davon, einfach für alle die Minijob-Grenze deutlich zu erhöhen?
Dominika Langenmayr: Davon halte ich gar nichts, im Gegenteil: Minijobs sollten stark eingeschränkt werden und ausschließlich bei haushaltsnahen Dienstleistungen möglich sein. Das würde Anreize schaffen, eine reguläre sozialversicherungspflichtige Beschäftigung aufzunehmen und die Arbeitszeit auszuweiten. Das gilt insbesondere für den Bereich des Bürgergelds. Hier arbeiten viele Leistungsempfänger in einem Minijob, weil einerseits die Anreize nicht ausreichend hoch sind für eine reguläre Beschäftigung. Andererseits öffnen die bestehenden Minijob-Regeln aber auch Tür und Tor für Schwarzarbeit, die sich praktisch nicht kontrollieren lässt: Man arbeitet offiziell nur in einem Minijob, bezieht Bürgergeld und der Arbeitgeber zahlt für Mehrarbeit schwarz am Fiskus und dem Jobcenter vorbei.

Junge Unionsabgeordnete kritisieren die Rentenpläne der Bundesregierung. Bundesministerin Bas verteidigt die Haltelinie und mahnt zur Sachlichkeit in der Debatte.
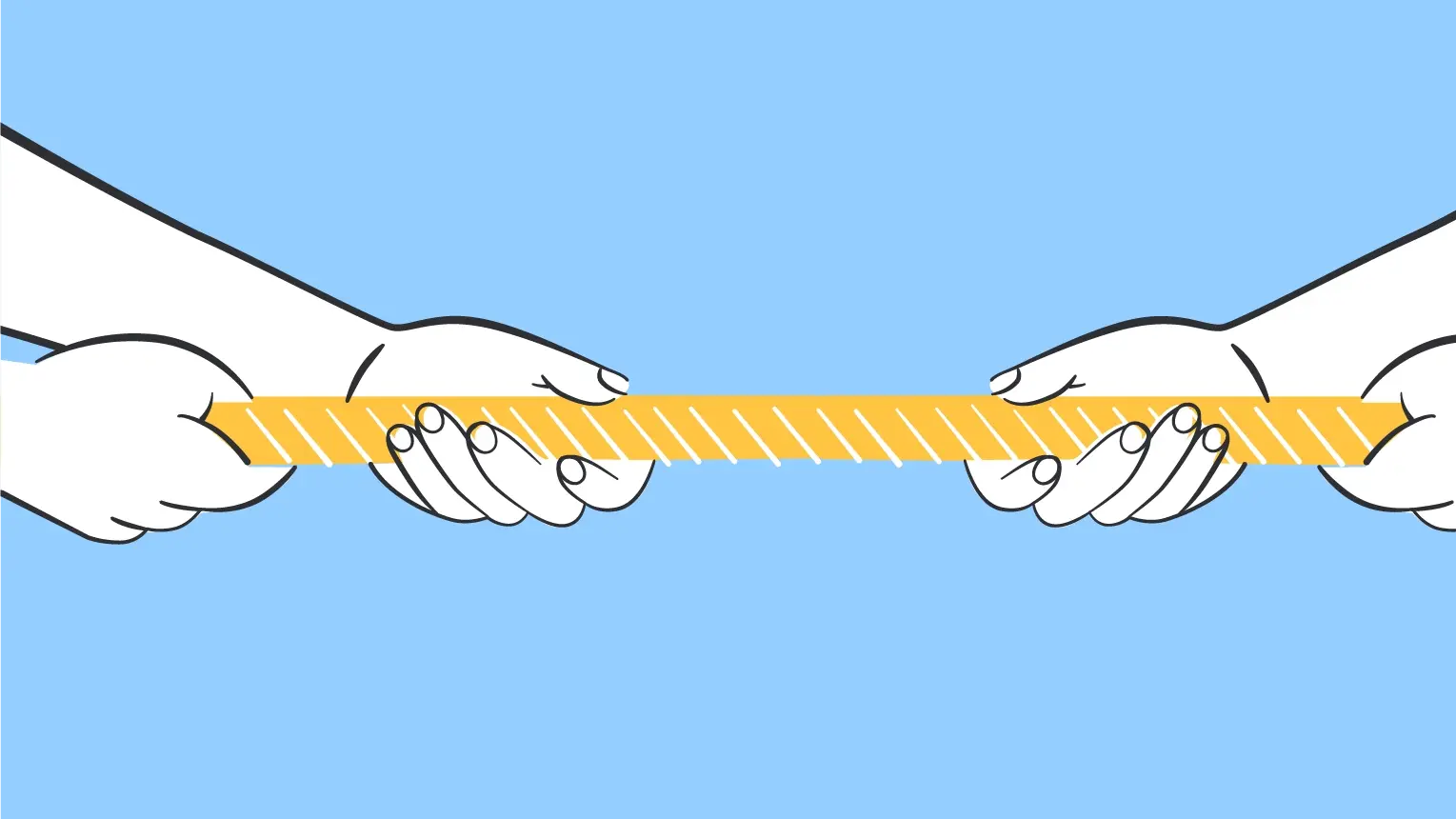
Muss die Erbschaftssteuer in Deutschland angehoben werden? Anja Krüger ist dafür, Thomas Sigmund hält es für den den falschen Weg: ein Pro und Contra.

Die Ziele des Sondervermögens seien nicht ausreichend definiert, warnen die Ökonomen Stefan Kolev und Philippa Sigl-Glöckner. Sie fordern höhere Ausgaben für Wissen.