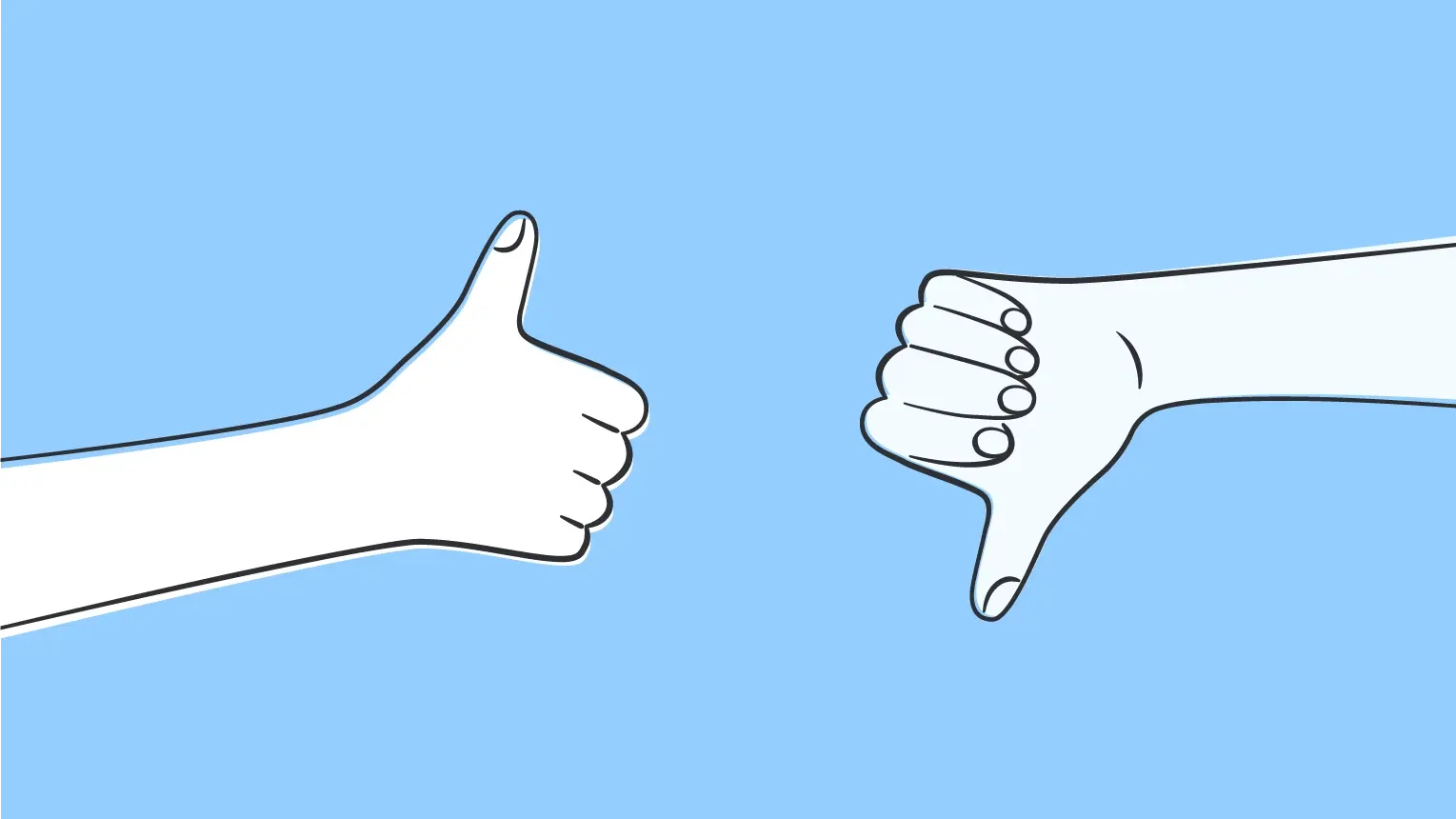Gesundheitsetat 2025 wächst : Warken verspricht schnelle Lösungen für Finanzprobleme
Die Kranken- und die Pflegeversicherung stehen finanziell unter Druck. Die Bundesregierung hat Kommissionen eingesetzt und will zeitnah Lösungen aufzeigen.

Die Hochleistungsmedizin in Krankenhäusern ist teuer. Steigende Kosten führen zu höheren Beiträgen.
Im Internet kursieren Bonmots über Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) in Anspielung auf den enormen Reformdruck, der wenig Anlass bietet, sich Zeit zu lassen. Auf einer Gesundheitsseite ist in einer Wortspielerei von "Warken auf Godot" die Rede oder von "Gesundheitspolitik im Warkenstand". Übersetzt: Bei der neuen Ministerin wird der erhoffte Elan vermisst.
Die Kernprobleme liegen auf der Hand: Die Kosten im Gesundheitswesen steigen permanent und zuletzt besonders stark, die Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung steigen mit und belasten die Versicherten. In der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) und der Sozialen Pflegeversicherung (SPV) ist eine finanzielle Schieflage entstanden, die sich mit ein paar Stellschrauben vermutlich nicht beseitigen lässt. Im Haushalt für die Jahre 2025 und 2026 wird den Versicherungen vom Bund ein Darlehen in Milliardenhöhe gewährt, das zurückgezahlt werden muss. Gesundheitsexperten sind sich einig: Ein großer Reformwurf muss her, und das schnell. Dass der bislang ausgeblieben ist, hat wohl auch mit politischen Risiken zu tun. Schon Warkens Amtsvorgänger haben das große Besteck lieber nicht angefasst.
Das Gesundheitssystem gilt als teuer und ineffizient
An Vorschlägen mangelt es nicht, auch von Arbeitgeberseite, die regelmäßig auf die Gefahr steigender Lohnnebenkosten verweist, aber systematische Reformen im Gesundheitswesen sind unbeliebt und riskant. Gleichwohl: Das deutsche Gesundheitssystem gilt im internationalen Vergleich als überteuert und in seinen Strukturen als ineffizient.
Der GKV-Spitzenverband hat als eine Ursache "teure Gesetze" ausgemacht und fordert ein Ausgabenmoratorium. Die alte Haushaltsweisheit lautet: Ausgaben müssen sich an Einnahmen orientieren.
Warken verweist auf die Fachkommissionen, die Vorschläge für Finanzreformen erarbeiten sollen und Anfang Juli (Pflege) beziehungsweise Mitte September (Gesundheit) vorgestellt wurden. Die Bund-Länder-Arbeitsgruppe "Zukunftspakt Pflege" soll Ende dieses Jahres ihre Eckpunkte präsentieren, die GKV-Kommission, die am 25. September starten soll, hat länger Zeit: Hier sollen Vorschläge für kurzfristige Entlastungen Ende März 2026 vorliegen, ein zweiter Bericht mit Vorschlägen für Strukturreformen soll bis Dezember 2026 fertig sein. Wann und welcher Form die Vorschläge der Kommissionen in Gesetzentwürfe einfließen, ist aber noch nicht absehbar.
GKV-Spitzenverband klagt gegen den Bund
Unterdessen greift der GKV-Spitzenverband zu einem ungewöhnlichen Mittel, um perspektivisch die Einnahmeseite zu stärken: Er klagt gegen den Bund. Konkret geht es um die Gesundheitsausgaben für Bürgergeldempfänger und zehn Milliarden Euro pro Jahr aus Steuergeldern. Die vom Bund angewiesene Pauschale decke bei weitem nicht die Kosten. Der Verwaltungsratsvorsitzende Uwe Klemens rügte: "Seit vielen Jahren setzen wir uns auf allen Ebenen dafür ein, dass diese rechtswidrige Unterfinanzierung beendet wird. Ohne Erfolg. Nun reicht es!"
Nach Berechnungen im Auftrag des Spitzenverbandes hätte eine kostendeckende monatliche Beitragspauschale für Bürgergeldbezieher 2022 bei 311,45 Euro gelegen, es seien aber nur 108,48 Euro gewesen, mittlerweile sind es 133,17 Euro, das sei ebenfalls nicht kostendeckend.
Der Gesundheitsetat im Überblick 📊
🩺 Die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) hat 2024 für Krankenhausbehandlungen rund 102 Milliarden Euro ausgegeben - der größte Posten. Die Kosten für Arzneimittel lagen bei rund 55 Milliarden Euro, für ärztliche Behandlungen fielen rund 50 Milliarden Euro an.
💰 Die Leistungsausgaben der GKV lagen 2024 insgesamt bei rund 312 Milliarden Euro.
📈 Die Klinikkosten legten zuletzt um 9,54 Prozent zu, die Arztkosten um 7,71 Prozent.
Die Not ist also groß, die Zeit knapp. In der Haushaltswoche über den Etat 2025 äußerte sich Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Mittwoch zur Zukunft des Sozialstaates und stärkte indirekt Warken den Rücken, als er sagte: "Wenn hier Kommissionen arbeiten und Vorschläge unterbreiten, dann dient das nicht dem Zeitverzug oder gar der Verschleppung, sondern dann dient das der wohlbedachten Vorbereitung eben jener Reformen, die auch breite Zustimmung finden müssen, wenn sie auf Dauer tragen sollen. So funktioniert Demokratie."
In der Schlussberatung des Gesundheitsetats für 2025, der Ausgaben in Höhe von rund 19,3 Milliarden Euro vorsieht (rund 2,6 Milliarden Euro mehr als 2024) und in der sogenannten Bereinigungssitzung fast unverändert blieb, versicherte Warken, die nötigen Reformen seien auf dem Weg. Für den Entwurf stimmten am Mittwochabend die Koalitionsfraktionen von Union und SPD, die Opposition von AfD, Grünen und Linken votierte geschlossen dagegen.
Die Spirale steigender Beiträge soll durchbrochen werden
Warken sagte, Leistungen in Gesundheit und Pflege müssten bezahlbar bleiben und fügte hinzu: "Versorgungssicherheit erfordert stabile Finanzgrundlagen." Warken versicherte: "Wir sind entschlossen, das weitere Auseinanderdriften zwischen Einnahmen und Ausgaben zu stoppen." Die Beitragsspirale der vergangenen Jahre müsse durchbrochen werden. Und sie betonte: "Uns ist allen bewusst, dass wir nicht mehr viel Zeit haben."
Paula Piechotta (Grüne) ging mit der Haushaltsplanung der Koalition hart ins Gericht. So würden die vier Milliarden Euro, die als Soforttransformationskosten für die Krankenhäuser eingeplant seien, aus Mitteln für Verkehrsprojekte umgelenkt und zweckentfremdet. Piechotta sprach von einem "Sündenfall" und dem unsolidesten haushaltpolitischen Vorgehen der vergangenen Jahre. Das Geld aus dem Sondervermögen für Verkehrsinfrastruktur werde auch noch "mit der Gießkanne" über die Kliniken ausgeschüttet.

„Unser Gesundheitssystem funktioniert für Besserverdienende und für die großen Gesundheits- und Pharmakonzerne, für alle anderen funktioniert gar nichts.“
Svenja Stadler (SPD) räumte ein, dass die SPD sich einen anderen Auszahlungsmechanismus gewünscht hätte, "einen Modus, der keine wirtschaftlichen Anreize schafft". Was nun vorliege, sei ein Kompromiss. Die SPD-Abgeordnete machte deutlich, dass die Reformen im Gesundheitswesen zügig kommen müssen. Es gehe darum, schnell zu konkreten Lösungsvorschlägen zu gelangen, "und zwar am liebsten gleich morgen."
AfD und Linke rügen unzureichende Gesundheitsversorgung
Martin Sichert (AfD) zeichnete ein düsteres Bild der Versorgungslage und sprach von einem ungerechten Gesundheitssystem voller Beschwernisse und überbordender Bürokratie. Das Gesundheitssystem in seiner jetzigen Form diene nicht den Menschen, sondern vor allem den Lobbyisten. Der Koalition fehle der Mut für echte Reformen, derweil stiegen die Beiträge immer weiter.
Kritik an der Versorgungslage kam auch von Tamara Mazzi (Linke), die ein Mehrklassensystem ausmachte: "Unser Gesundheitssystem funktioniert für Besserverdienende und für die großen Gesundheits- und Pharmakonzerne, für alle anderen funktioniert gar nichts."
Peter Aumer (CSU) wertete den Etat 2025 als Zeichen dafür, dass die Koalition die Prioritäten bei Gesundheit und Pflege setze. Gleichwohl seien Strukturreformen nötig. "Uns allen ist klar, wir können nicht jedes Jahr Milliarden nachschießen, ohne strukturelle Antworten zu geben." Aumer versprach: “Wir gehen die Themen beherzt an.”

Viele Krankenhäuser müssen saniert und klimaneutral umgebaut werden. Die Kosten sind hoch, die Länder investieren zu wenig. Das soll sich nun ändern.

Mit zwei neuen Gesetzentwürfen will die Bundesregierung den Pflegeberuf attraktiver machen und die Versorgung verbessern.

Die Pflegeversicherung steht finanziell unter Druck, in der Versorgung fehlen nach wie vor Fachkräfte. Der Deutsche Pflegerat macht sich für Reformen stark.