
Ottmar Edenhofer im Interview : "Wir müssen die Temperaturkurve zurückbiegen"
Nach der enttäuschenden COP 30 rät Klimaökonom Ottmar Edenhofer zur Nutzung von Technologien zur CO2-Entnahme – und neuen internationale Klimakooperationen.
Herr Edenhofer, die Ergebnisse des am letzten Samstag zu Ende gegangenen 30. Weltklimagipfels haben viele ernüchtert. Weder konnten sich die Staaten auf einen Plan für den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen einigen noch auf konkrete Zusagen für die Klimafinanzierung in ärmeren Staaten. Warum braucht es die COP trotzdem?
Ottmar Edenhofer: Weil es wichtig ist, dass sich die Weltgemeinschaft trifft. Die Klimakonferenz ist im Augenblick vielleicht das einzige multilaterale Format, das noch funktioniert - und das, obwohl sich die USA zurückgezogen haben. Allerdings gibt es fundamentale Probleme: Die Staaten versprechen zu wenig, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens einzuhalten; und das, was sie versprechen, halten sie nur unzureichend ein.
Mancher stellt die Konferenz deshalb grundsätzlich in Frage...
Ottmar Edenhofer: Aber abschaffen sollte man sie nicht, sondern weiterentwickeln. Statt vager Abschlusserklärungen sollten dort konkrete Projekte beschlossen werden, deren Fortschritt im nächsten Jahr überprüft wird. Der von Brasiliens Präsident Lula da Silva vorgestellte Tropenwaldfonds ist dafür ein gutes Beispiel. Er kann funktionieren, auch wenn nicht alle Staaten zustimmen. Ein anderes Projekt könnte die Besteuerung des internationalen Flugverkehrs sein. Darüber ließen sich Milliarden Euro pro Jahr mobilisieren, um in anderen Ländern den Kohleausstieg zu finanzieren oder Öl- und Gasimporte zu reduzieren.

Wie könnte das genau aussehen?
Ottmar Edenhofer: Nehmen wir China und die EU: Beide sind Nettoimporteure von Öl und Gas. Würden sie vereinbaren, eine Gebühr auf ihre Öl- und Gaseinfuhren zu erheben und diese in einen Fonds einzahlen, könnte daraus die Energiewende in Ländern des globalen Südens unterstützt werden.
Welchen Anreiz hätten China und die EU so zu kooperieren?
Ottmar Edenhofer: Ein wichtiger Anreiz liegt im sogenannten Terms-of-Trade-Effekt: Fördern China und die EU die Energiewende in anderen Ländern, sinkt die Nachfrage nach fossilen Brennstoffen auch global und damit der Weltmarktpreis - was für China und die EU von Vorteil ist. Hinzu kommt der Nutzen vermiedener Klimaschäden.
„Der Klimawandel wird nicht verschwinden. Es wird weiter die Klimapolitik in der EU geben.“
Offen ist in Belém auch geblieben, wie die Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzt werden soll. Ein Eingeständnis, dass das Ziel nicht mehr zu erreichen ist?
Ottmar Edenhofer: Zweifellos werden wir die 1,5-Grad-Marke überschreiten. Damit hat sich aber das 1,5-Grad-Ziel nicht erledigt. Unsere Bemühungen müssen sich darauf richten, die überschießende Temperaturkurve durch Negativemissionen, also Technologien zur Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre, wieder zurückzubiegen.
Kritiker verweisen auf hohe Kosten und unklare Umweltauswirkungen der unterirdischen CO2-Speicherung. Warum nicht effektiver den Ausstoß von Emissionen verhindern und auf natürliche Senken wie Moore und Wälder setzen?
Ottmar Edenhofer: Hätten wir vor zehn Jahren begonnen, die Emissionen so stark zu reduzieren, wie wir das versprochen haben, dann wäre das noch eine Option. Doch mit Emissionsvermeidung und natürlichen Senken allein können wir jetzt das 1,5-Grad-Ziel nicht mehr erreichen. Die Frage ist lediglich, ob wir das Überschießen einigermaßen begrenzen können. Dazu braucht es unbedingt technische Lösungen, wie Filter für die CO2-Entnahme aus der Luft und Verfahren zur Abscheidung und Speicherung von CO2 aus Abgasen. Solche Technologien sind teuer, aber die Schäden eines Temperaturanstiegs weit über 1,5 Grad wären sicher noch teurer.
Der Bundestag hat das Kohlendioxidspeichergesetz beschlossen und stellt über den Klima- und Transformationsfonds 2026 erstmals Mittel für Negativemissionsprojekte bereit. Ist das ausreichend?
Ottmar Edenhofer: Es ist ein Schritt in die richtige Richtung, Pilotprojekte zu fördern. Aber es braucht mehr: Der EU-Emissionshandel muss so gestaltet werden, dass solche Technologien zugelassen und Netto-Negativemissionen finanziert werden können - etwa über Zertifikate, die Emittenten verpflichten, für jede Tonne heute ausgestoßenen Kohlendioxids in Zukunft eine Tonne der Atmosphäre zu entziehen.
Vor der Beginn der COP 30 hat nicht zuletzt das Ringen um das Klimaziel 2040 gezeigt, wie uneins die EU beim Klimaschutz ist. Droht ein Rollback?
Ottmar Edenhofer: Es ist unverkennbar, dass Teile der Industrie die Gunst der Stunde versuchen zu nutzen, um den Green Deal im Kern zu erschüttern. Doch die geforderte Abschaffung des Emissionshandels wäre unverantwortlich. Der Klimawandel wird nicht verschwinden. Es wird weiter die Klimapolitik in der EU geben. Deren Instrumente könnten aber noch viel teuer werden als der Emissionshandel.
Auch lesenswert

Mehr Geld zum Schutz von Tropenwäldern, aber kein Plan für den Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas. Was auf der Klimakonferenz beschlossen wurde und was offen bleibt.
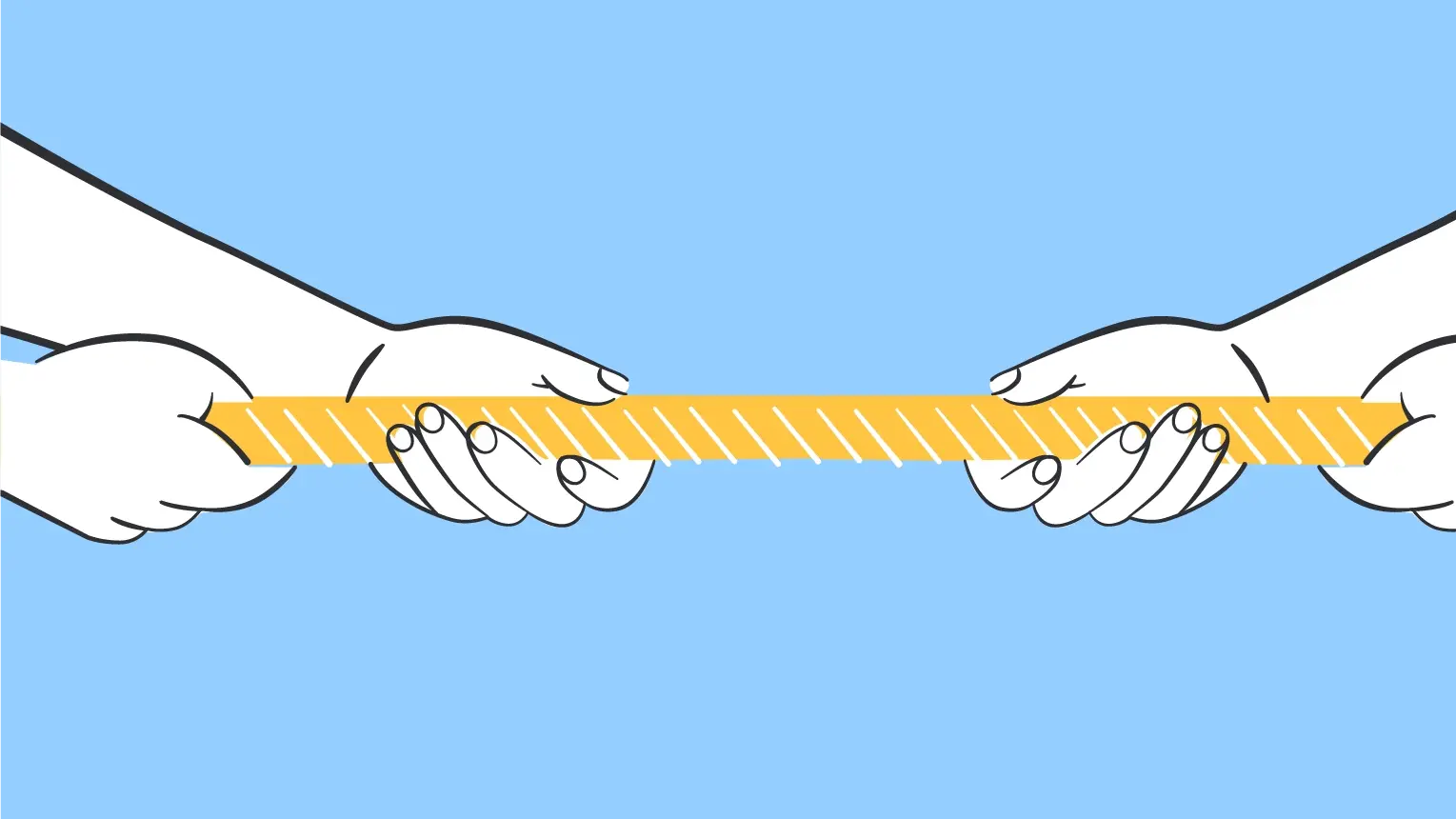
Ist die Regierung mit ihrem Kohlendioxid-Speicherungsgesetz auf dem richtigen Weg? Ja, meint Klaus Stratmann, nein, findet Ann-Kathrin Büüsker.

Bis 2045 will Deutschland klimaneutral sein. Wie die Zementindustrie auf dieses Ziel hinarbeitet, zeigt der Baustoffhersteller Holcim in Höver. Ein Werksbesuch.
