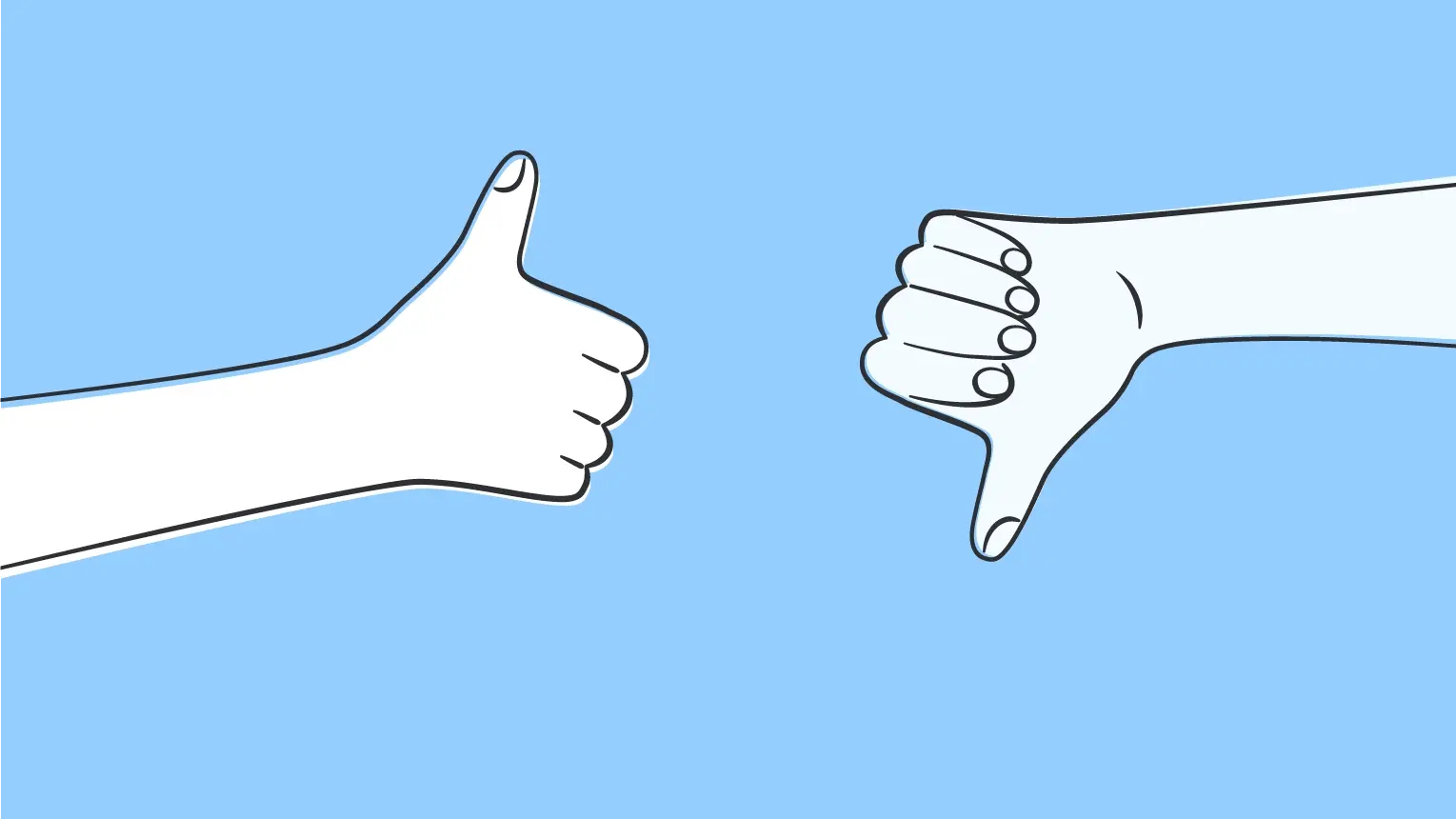Größter Etat aller Ministerien : Doppelter Renten-High-Noon in Berlin
Bis morgens nach zwei Uhr tagt der Koalitionsausschuss zur Rentenreform. Während das Plenum debattiert, tritt Kanzler Merz vor die Presse und erklärt die Pläne.
Eigentlich sollte am Freitagmorgen um 9 Uhr die Debatte zum Einzelplan 11 starten, der das Budget des Ministeriums von Bärbel Bas (SPD) festlegt. Das an sich wäre schon ein rentenpolitischer Gipfel. Aber der Beginn verzögerte sich.
Die Abgeordneten von CDU und CSU debattierten zu diesem Zeitpunkt noch in einer eigens am frühen Morgen anberaumten Fraktionssitzung über den anderen Gipfel, nämlich den Koalitionsausschuss, der zuvor bis Freitagmorgen um 2:30 Uhr getagt hatte.

Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) lehnt Änderungen am Rentenpaket vehement ab. Ein Entschließungsantrag soll die Kritiker in der Union nun beruhigen.
Darin hatten sich die Spitzen der Koalitionsparteien unter anderen mit dem Widerstand zahlreicher Unionsabgeordneter gegen einen Gesetzentwurf der Bundesregierung befasst, der aus deren Sicht, wie auch aus nahezu einhelliger Sicht von Wirtschaftswissenschaftlern, die Ausgaben der Gesetzlichen Rentenversicherung in der Zukunft zu stark steigen lässt.
Erst eine Viertelstunde nach dem angesetzten Sitzungsbeginn stellte Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) fest: "Die CDU/CSU-Fraktion ist jetzt da. Heute ist 9 Uhr um 9:17 Uhr." Die Debatte konnte beginnen.
Spitzen der schwarz-roten Koalition hatten sich am frühen Morgen geeinigt
Allerdings traten wenige Minuten später im Kanzleramt die Parteivorsitzenden vor die Presse und berichteten über die Ergebnisse des Koalitionsausschusses. Um 9:50 Uhr meldete die Nachrichtenagentur Reuters, dass sich die Spitzen der schwarz-roten Koalition in der Nacht auf einen Entschließungsantrag geeinigt hätten, in dem sie eine grundsätzliche Rentenreform im kommenden Jahr zusagen wollten. Außerdem sollen aus den Aktienbeständen des Bundes - dazu gehören Beteiligungen an Telekom, Post und Commerzbank - zehn Milliarden Euro bereitgestellt werden, um die private Altersvorsorge zu stärken.
Fürs zweite Halbjahr 2026 kündigte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) eine größere Rentenreform an. Ob das den jungen Abgeordneten genügt, um die jetzt von der Bundesregierung geplanten Änderungen mitzutragen?

„15 Minuten Verspätung zum Sitzungsbeginn: Nichts passt symbolisch besser zu den Verspätungen der Herbstreformen.“
Die Koalitionsspitzen wollen daran festhalten, dass das Rentenniveau auch über das Jahr 2025 hinaus nicht unter 48 Prozent sinkt, obwohl der Nachhaltigkeitsfaktor in der Rentenversicherung das eigentlich vorsieht. Diese verlängerte sogenannte Haltelinie soll bis 2031 gelten. Doch wie geht es dann weiter? Bas' Gesetzentwurf sieht vor, dass ein ab dann möglicherweise sinkendes Rentenniveau von den 48 Prozent ausgeht. Doch genau das wollen eine Reihe der Abgeordneten der CDU/CSU-Fraktion nicht mittragen. Das stehe so nicht im Koalitionsvertrag, argumentieren sie. Sie wollen keine Vorfestlegungen, tragen lediglich mit, das Rentenniveau bis 2031 festzulegen.
Arbeitsministerium verwaltet mit fast 200 Milliarden Euro größten Etat
Der Gesetzentwurf kam am Freitagmorgen im Bundestag zur Sprache. Formal ging es da jedoch um den Etat des Arbeits- und Sozialministeriums für 2026. Letzter Tag in der Sitzungswoche zum Bundeshaushalt 2026. Das Arbeits- und Sozialministerium hat den größten Etat aller Ministerien: 197,34 Milliarden Euro darf Bas 2026 ausgeben, 127,8 Milliarden Euro davon fließen als Steuerzuschuss an die klamme Rentenversicherung. Immerhin ist der Zuschuss an die allgemeine Rentenversicherung um knapp eine halbe Milliarde Euro geringer veranschlagt als im ursprünglichen Regierungsentwurf.
Der AfD-Abgeordnete René Springer machte in seinem Debattenbeitrag vor allem Ausländer für die schwierige Situation der sozialen Sicherungssysteme verantwortlich: "Eine Regierung, die 700.000 Ukrainern, 500.000 Syrern, 200.000 Afghanen und 100.000 Irakern Bürgergeld, Krankenversicherungen und kostenlose Wohnungen finanziert und dafür den eigenen Bürger gnadenlos abkassiert, muss abgewählt werden", forderte er.
Kathrin Michel verwies für die SPD-Fraktion darauf, dass 70 Prozent der Rentner in Ostdeutschland allein von der gesetzlichen Rente lebten. Diese Personen müssten "im Alter sicher leben können", deshalb sei "das Festhalten an der Haltelinie bei 48 Prozent richtig und wichtig", damit das Rentenniveau nach 2031 nicht um einen Prozentpunkt sinke, was "für viele Menschen hunderte Euro weniger am Jahr bedeuten" würde.
Grüne fordern: Abgeordnete, Beamte und Selbstständige sollen in Rententopf einzahlen
Für Leon Eckert von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen passte die 15-minütige Verspätung des Sitzungsbeginns "zu den Verspätungen der Herbstreformen und der angekündigten Gesetzpakete der Bundesregierung". Das Rentenpaket oder die Bürgergeldreform seien bereits vor Monaten angekündigt, aber immer wieder verschoben worden. Aus Sicht der Grünen müsse in der Rentenversicherung die Beitragsbemessungsgrenze steigen. Abgeordnete, Beamte und Selbstständige sollten einzahlen.
Rentenniveau und Rentenhöhe im Überblick
📊 Rentenniveau: Lag die Rente eines Standardrentners, also eines Rentners mit 45 Beitragsjahren und einem durchschnittlichen Verdienst, im Jahr 2000 noch bei 53 Prozent des durchschnittlichen Einkommens eines Arbeitnehmers, liegt es zurzeit nur noch bei 48 Prozent.
💶 Rentenhöhe: Trotz sinkenden Rentenniveaus ist die Brutto-Standardrente im Zeitraum 2000 bis 2024 in Westdeutschland von 13.373 Euro pro Jahr auf 20.768 Euro gestiegen. Besondere Zuwächse gab es in Ostdeutschland, denn dort sind die Renten von 86,8 Prozent des Westniveaus auf 100 Prozent bis Mitte 2023 gewachsen.
👵 Demografie: Deutschland wird älter. Der sogenannte Altenquotient ist seit dem Jahr 2000 von 26,76 auf 38,05 im Jahr 2024 gestiegen. Heißt: Auf 100 Personen im erwerbsfähigen Alter kommen immer mehr Über-65-Jährige.
📈 Nachhaltigkeitsfaktor: Damit der wachsende Anteil von Menschen im Rentenalter die Beitragszahler in der Gesetzlichen Rentenversicherung nicht überfordert, sollen die Renten langsamer steigen, was zu einem sinkenden Rentenniveau führt (aber nicht zu sinkenden Rentenzahlungen).
Yannick Bury (CDU) ging auf die Situation am Arbeitsmarkt ein. Die Reform des Bürgergeldes hin zu einer Grundsicherung schaffe mehr Anreize zur Aufnahme einer Arbeit für Leistungsempfänger. Bury kritisierte den AfD-Redner Springer. Dessen Rede habe "zu 80 Prozent" daraus bestanden, "gegen Ausländer zu hetzen". Viele Menschen mit Migrationshintergrund brächten sich "in diesem Land fleißig ein". Bury gestand indes zu, dass der Bundeszuschuss an die Rentenversicherung nach jetzigem Stand bis zum Jahr 2029 auf 150 Milliarden Euro steigen werde und dass deshalb Handlungsbedarf bestehe.
Tamara Mazzi (Die Linke) begann ihre Rede mit einem Verweis auf ihren Vater, der trotz eines langen Berufslebens nur 236 Euro Rente bekomme. "Millionen Menschen in Deutschland haben ihr Leben lang hart gearbeitet und sind von Altersarmut bedroht", kritisierte Mazzi. Sie forderte ein Rentenniveau von 53 Prozent sowie "eine solidarische Mindestrente".
Arbeitsministerin Bas sieht die richtigen Weichen gestellt
Ministerin Bärbel Bas sagte, die schwarz-rote Koalition setze mit dem Bundeshaushalt 2026 "die richtigen Schwerpunkte". Sie verwies darauf, dass 2026 das Gesamtbudget der Jobcenter um eine Milliarde Euro steige, "um eben auch mehr Eingliederung und Vermittlung möglich zu machen". Zur Alterssicherung sagte sie: "Mit der Stabilisierung des Rentenniveaus, der Mütterrente, der Betriebsrente, der Frühstartrente, der Aktivrente und einer Reform der privaten Altersvorsorge stellen wir jetzt schon die richtigen Weichen."
Der Einzelplan 11 wurde in zweiter Lesung mit den Stimmen der Fraktionen von CDU/CSU und SPD angenommen. Die Opposition aus AfD, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke stimmte dagegen.
Auch lesenswert

Während die einen positiv auf die Rente blicken, können sich andere den Renteneintritt nicht leisten. Drei Menschen erzählen über das Ende ihres Berufslebens.

Die Pflegeversicherung wird im Haushalt 2026 mit einem zusätzlichen Darlehen gestützt. Die Opposition fordert entschlossene Reformen.

Die Innere Sicherheit in Deutschland und die Migrationspolitik der Bundesregierung prägen die Debatte über den Innen-Haushalt 2026.