Schuldenwette auf die Zukunft : Die Investitionsoffensive muss Hindernisse überwinden
Das 500 Milliarden Euro Sondervermögen soll mittels neuer Schulden die marode deutsche Infrastruktur wieder in Schuss bringen. Doch es gibt Risiken.
Deutschland fährt auf Verschleiß. Galt Deutschlands Infrastruktur lange als Standortvorteil, sind die hiesigen Straßen, Schienen und Schleusen bestenfalls noch Durchschnitt. Im jüngsten Ranking der IMD Business School rutschte Deutschlands Infrastruktur seit 2020 von Platz 11 auf Rang 20 ab.
Um den Investitionsstau im Land aufzulösen, haben Union und SPD ein beispielloses Infrastruktur-Sondervermögen in Höhe von 500 Milliarden Euro geschaffen, also Kreditmöglichkeiten für den Staat in historischem Ausmaß. "Wir investieren so stark wie noch nie zuvor in die Zukunftsfähigkeit unseres Landes", sagte Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) bei der Einbringung des Bundeshaushalts 2025 in den Deutschen Bundestag. "Wir haben hier im Parlament die Fesseln endlich gelöst."
Deutschland hat in den letzten Jahrzehnten zu wenig investiert
Doch einen so großen Schuldentopf aufzulegen, birgt auch Risiken. Die Bundesländer könnten ihren Anteil an dem Finanztopf nicht für Investitionen nutzen, sondern zum Stopfen von Haushaltslöchern, so eine Sorge. Und der Bund könnte auf einem Teil der Investitionsmittel, mit denen er die schwächelnde Wirtschaft ankurbeln will, sitzen bleiben. Gelingt es Bund, Ländern und Kommunen nicht, das Geld effizient auszugeben, droht Klingbeil sein Versprechen, den Bürgern den Alltag zu erleichtern, nicht einlösen zu können.
Ökonomen kritisieren schon lange die unzureichenden öffentlichen Investitionen in Deutschland. Im Vergleich zu anderen Industrieländern schneide die Bundesrepublik "eher schlecht ab", schrieb der Internationale Währungsfonds (IWF) im Vorjahr. Die Investitionen seien insbesondere in den 1990er Jahren rückläufig gewesen "und sind seitdem gerade so ausreichend, um die Abschreibungen auszugleichen", so der IWF. Deutschland fuhr auf Verschleiß.

Neue Brücken, neue Straßen, neue Gleise braucht das Land. Mit dem Sondervermögen Infrastruktur soll das gelingen.
Die schwarz-rote Koalition geht dieses Problem nun an und hat für das 500-Milliarden-Euro-Sondervermögen eigens das Grundgesetz geändert, damit der Sondertopf nicht gegen die Schuldenbremse in der Verfassung verstößt. 100 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen gehen an die 16 Bundesländer, weitere 100 Milliarden Euro fließen in den Klima- und Transformationsfonds, aus dem klimapolitische Maßnahmen finanziert werden.
Über die übrigen 300 Milliarden Euro verfügt der Bund. So will Klingbeil in diesem Jahr 27 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen ausgeben. 11,7 Milliarden Euro fließen allein in den Verkehrssektor, vier Milliarden Euro in die Digitalisierung.
Bürokratie und Verwaltungsengpässe gefährden den Effekt des Sondervermögens
Damit das Geld zusätzlich investiert wird und nicht Investitionen aus dem regulären Etat in das Sondervermögen geschoben werden, müssen die Investitionsausgaben im Bundeshaushalt mindestens zehn Prozent betragen. Ebenso will der Bund in Berichten überprüfen, ob die 500 Milliarden Euro zielgerichtet eingesetzt werden. Aber dennoch ist die Sorge unter Ökonomen groß, dass genau das nicht passiert.
Schon seit vielen Jahren bekommt der Staat seine Investitionsmittel nicht ausgegeben. Im vergangenen Jahr schoben Bund und Länder 76 Milliarden Euro an nicht verausgabten Mitteln vor sich her. Ein Grund dafür: Verwaltungsengpässe.
Insbesondere in den kommunalen Bauverwaltungen fehlt Personal. So ist zwar Geld für neue Bauprojekte da, aber keine Bauingenieure, die sie planen könnten. Hinzu kommen langsame Prozesse und Bürokratie. Bekommt der Staat diese Probleme nicht gelöst, drohe das Sondervermögen in Teilen zu verpuffen, warnt die Vorsitzende des Sachverständigenrates, Monika Schnitzer. Weil Firmen dank guter Auftragslage und Fachkräftemangel höhere Preise vom Staat verlangen können.
Die Länder können nahezu frei über den Einsatz der 100 Milliarden entscheiden
Das zweite Problem: Der Bund hat in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, dass die Bundesländer Geld vom Bund oft nicht für die Zwecke ausgaben, für die es eigentlich vorgesehen war. Unionshaushaltspolitiker Yannick Bury (CDU) mahnt deshalb, das Sondervermögen dürfe "nicht zum Selbstbedienungsladen" für die Bundesländer werden. Deshalb wollte die Bundesregierung den Ländern Auflagen machen, wie sie die 100 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen auszugeben haben.
So sollten die Länder das Geld nicht in bereits bestehende und auch nicht in Projekte stecken dürfen, an denen sich der Bund beteiligt. Zudem sollten die Länder "mindestens" 60 Prozent ihrer Gelder an die Kommunen weiterreichen, weil dort der Großteil aller staatlichen Investitionen erfolgt. Doch die Länder pochten auf ihre Selbstständigkeit. In den Verhandlungen mit dem Bund kippten sie einen Großteil der Auflagen. Sie können nun faktisch nahezu frei über das Geld entscheiden.

Der NRW-Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU) warnt vor zu viel Steuerung aus Berlin: Kommunen und Länder wüssten am besten, welche Projekte vor Ort sinnvoll sind.

Den Städten und Gemeinden brechen die Einnahmen weg, gleichzeitig haben sie hohe Ausgaben. Es könnte mehr als das geplante 100-Milliarden-Sondervermögen nötig sein.
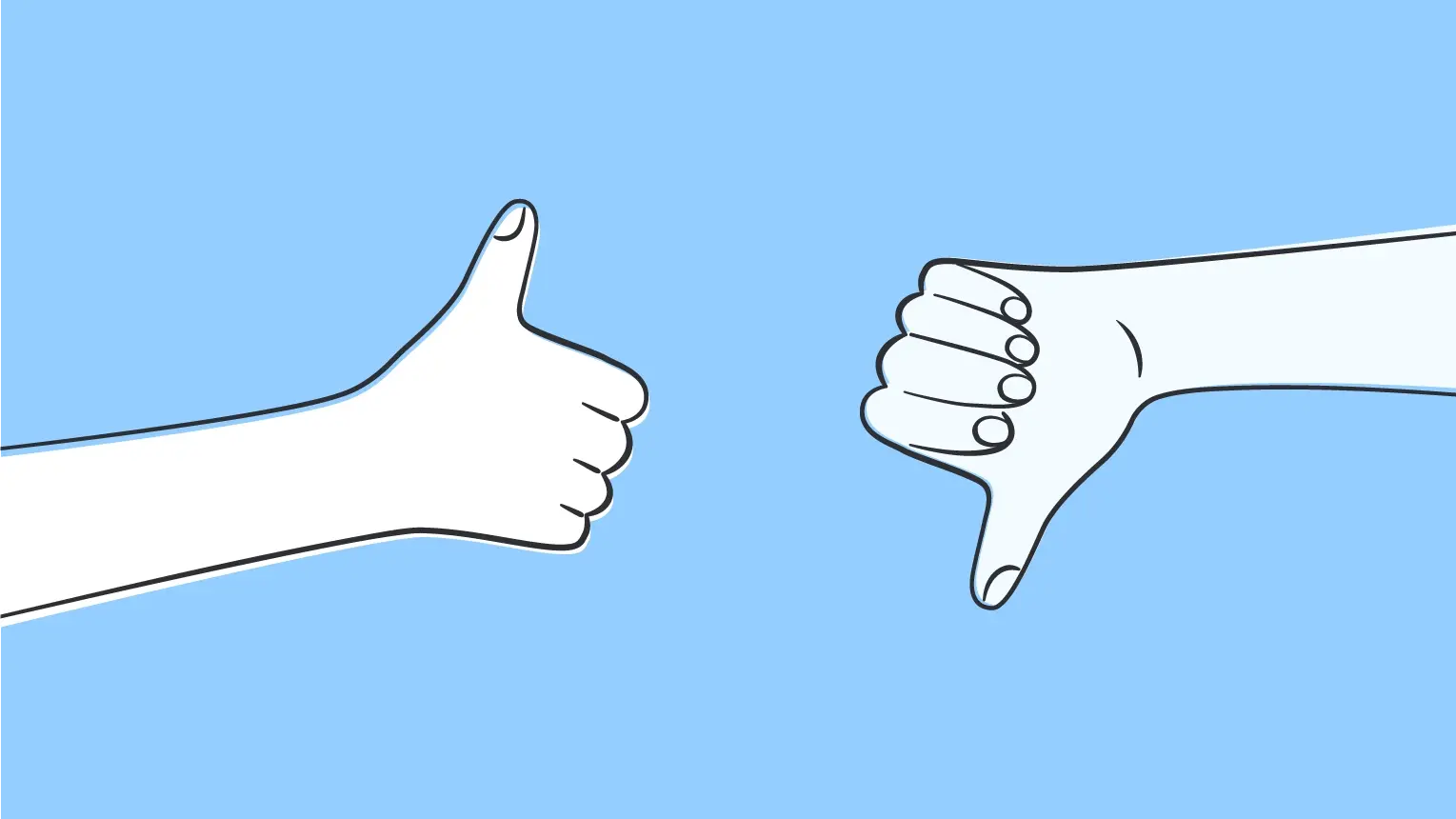
Sollten die Steuern erhöht werden, um die milliardenschwere Haushaltslücke in der Finanzplanung auszugleichen? Hannes Koch und Jan Hildebrand im Pro und Contra.
Investoren halten das Infrastruktur-Sondervermögen für ein lange überfälliges Signal, dass in Deutschland endlich etwas vorangeht. Doch jetzt kommt es auf die Umsetzung an. Bringt der Staat das Geld nicht rasch und gleichzeitig effizient auf die Straße, droht sich bei Bürgern neuer Frust einzustellen, warnen Ökonomen. Und auch der ökonomische Preis wäre hoch: So werden sich die Zinskosten des Bundes durch die hohe Schuldenaufnahme der neuen Bundesregierung binnen vier Jahren von 30 auf über 60 Milliarden Euro mehr als verdoppeln.
Der Autor ist Chefreporter Politik beim "Handelsblatt".
